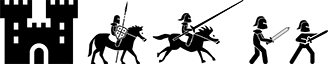
Tour de Klamp
Reiseführer für Zeitreisende
Wagrier — „die an den Buchten leben“
Beginnen wir unsere Reise in einer weit entlegenen Zeit. Einer Zeit, in der slawische Völkerschaften ein beachtliches Stück Holsteins innehatten. Einer Zeit, die für die Geschichte unseres Landes von großer Bedeutung ist.
Wir sind im 4. Jahrhundert. Das Land östlich der Elbe bis weit hinter der Oder besteht aus Mischwäldern mit Eichen, Buchen und Birken. In den Senken, weder See noch Land, machen Moore das Vorankommen schwer. Flüsse mit ausufernden Sumpfgebieten bilden natürliche Grenzen. Dieser Urwald trägt wegen seiner Undurchdringlichkeit den Namen „Isarnho“ (Eisenwald).
Es ist der Beginn der Völkerwanderung. In den nächsten zwei Jahrhunderten ziehen Angeln, Sachsen, Teutonen und viele andere germanische Stämme nach Westen und hinterlassen nahezu menschenleere Gebiete. Das bleibt nicht unbemerkt. Von seinen Inseln kommt der Wikinger herüber, um das Land der Angeln und Jüten zu besetzen. Den abziehenden Goten sind die Slawen auf dem Fuße gefolgt und bald wagen sich auch die ersten Slawen über das trügerische Wasser der Ostsee und landen an der Küste Ostholsteins.
In den folgenden Jahrhunderten entstehen durch dichte Wälder voneinander getrennte Siedlungen. Ein Teilstamm der slawischen Abodriten bewohnt den gesamten Raum zwischen der Kieler Förde und der Lübecker Bucht. Im nordöstlichen Winkel, wo das flache Land durch die Brökau, den Dannauer und den Gruber See als Insel vom Festland abgeschnitten ist, legen die Slawen den Grund zu ihrer Hauptstadt „Starigard“, das heutige Oldenburg. Dieses Gebiet trägt auch heute noch die Spuren seiner Siedler im Namen: Wagrien.
Auf den Spuren der Slawen
Zurück in der Gegenwart machen wir uns auf die Suche nach den Spuren, die uns die Wagrier hinterlassen haben. Wir fahren auf der Landstraße 259 vom „Seekrug“ in Richtung Giekau und entdecken rechts die hohe Koppel — „Burgkamp“ — wo man viele Steintrümmer und Mauerreste zutage förderte. Die steile Böschung ist auch gleichzeitig die Südseite von den Überresten einer slawischen Wallanlage, „Wallberg“ genannt. Die Anlage hat einen Durchmesser von ca. 100 Meter und liegt auf dem Flurstück „Radebrook“. Ausgrabungen von 1952 bis 1953 brachten überwiegend mittelslawische Keramikscherben ans Licht. Die Westseite der Anlage wurde durch den Bau der Landstraße zerstört, die nun durch den Ringwall hindurch führt. Die Besiedlungsdauer der slawischen Burg beginnt wahrscheinlich im 8./9. und endet im 11. Jahrhundert.
In der Nähe der Burganlage entdecken wir neben einigen Grabhügeln aus der Bronzezeit (die „Hossen“ in Ölböhm und den Grabhügel in Fresendorf) auch sechs slawische Grabhügel im Wald „Heinböts“ und zwei befestigte Turmhügel aus dem Mittelalter („Waterburg“ und „Auf der Bleiche“). Google Maps
Zu der Siedlungsinsel um den Ringwall gehörte wahrscheinlich auch der Ort Daventz [1]. Der Sage nach lag er südlich von Giekau im „Gute Clamp“ auf dem Flurstück „Dorpskoppel“ (Dorfkoppel). Google Maps
Erstmalig wurde Daventz 1361 in einer Urkunde erwähnt und gehörte zu der Zeit dem Knappen Vollrath von Timmendorf [2]. Daventz ist damit die älteste bekannte schriftliche Erwähnung eines Dorfes in unserer Gemeinde. Die Siedlung wurde später niedergelegt (aufgegeben) und ist an den Hof Klamp gekommen. Auf der Feldmark war auch ein Grabhügel, der aber abgetragen wurde.
Deutungen des Namens Klamp
Niederdeutsch klump oder klamp: etwas womit man einem anderen Ding Halt, Festigkeit, Verbindung oder Zusammenhalt gibt; Klotz, Querriegel, auch einen Steg über einen Graben.
Niederländisch klamp: Klammer, Zapfen, Band aber auch Brücke, Steg.
Englisch clamp: Balken, Latte, Leiste, Stück Holz zur Verstärkung und Befestigung.
Norwegisch und Schwedisch klamp: Klotz, Baumstumpf, Holzkloben.
Es stecken also zwei Bedeutungen in dem Wort: Klammer und Klumpen. Beide liegen auch schon in dem Zeitwort klimpan, von dem Klampe abstammt und dessen Grundbedeutung nicht nur spalten sondern auch klammern, verbinden, haften ist.
400 Jahre Daventz — Aus Akten und Urkunden
- 25. Juli 1361 — Verkauf der jährlichen Einkünfte für 100 Mark an Domherr Albertus de Stralendorpe zu Lübeck [3]
- 1433 — Eintrag im Zehntenregister (Steuerregister) des Bischofs von Lübeck Johann VII. Scheele
- 1437 — Henneke Rantzow „wonaftig in dem kerspele to Luttigenborg“ kauft die Einkünfte für 200 Mark zurück.
- 1467 — erscheint der Name Klamp erstmalig im Lütjenburger Kirchenrechnungsbuch: „Clawes Rantzow tom klampe“ hat 100 Mark erhalten. Clawes ist der Sohn von Henneke.
- 1640 — wird Daventz wieder urkundlich erwähnt; es wird gemeinsam mit Gut Klamp verkauft.
- 1663 — Bertram und Christine Reventlow verkaufen an Haus Rantzau die Güter Klamp und Panker „mit den Dörfern Gardendorff, Darye, Wentorff und Vogelstorff, so nach Panker gehören, und das niedergelegte Dorf Daventze, so dem Hoffelde von Clampe einverleibet.“
- 1739 — Zum letztenmal taucht der Name in einer Appunktation zum Verkauf der Güter Panker und Klamp auf. Nach der Aufstellung der laufenden Ausgaben der Güter erhielt der Pastor in Giekau „wegen Devens jährlich Baar 2 Reichsthaler.“ An die Kirche musste für niedergelegte Hufen gezahlt werden. Dies ist der letzte namentliche Eintrag in Akten und Urkunden.
1) auch Daventze, Devenz, Daventz, Davens - sziewiec (slawisch neun) also „die neun“ (Dörfer oder Sippen)
2) vgl. Topographie der Herzogthümer Holstein 1793-1862, Johannes von Schröder
3) vgl. Das Lübecker Domkapital im Mittelalter 1160-1400, Adolf Friederici
Gutsherrschaft, Hufen und Instenstellen
In Ostholstein gab es bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine feudale Herrschaftsform, die sich seit dem Mittelalter mit der Ostkolonisation in den östlichen Gebieten des Heiligen Römischen Reichs entwickelte. Der adelige Gutsherr verfügte nicht nur über weiträumiges Grundeigentum von 100 oder mehr ha (Gutsbezirk), auf dem überwiegend Getreide angebaut und häufig auch handwerkliche Produktion mit örtlichem Monopol ausgeübt wurde (Braugerechtsame, Mühlenzwang, Ziegel- und Kalkbrennmonopole). Er hatte auch mittels Erbuntertänigkeit sowie übertragener Straf- und Polizeigewalt in der Agrargesellschaft eine beherrschende Stellung als Mittler der landesherrlichen Gewalt inne. Die Abhängigkeit des Bauern vom Grundherrn fand ein rechtlich fundiertes Ende im Jahre 1796. Aufgeklärte Gutsherren schafften auf ihren Besitzungen die Leibeigenschaft bereits früher ab. Im Herzogtum Holstein teilte 1739 Hans zu Rantzau sein Land in Pachtbetriebe auf und erließ schrittweise Frondienste.
Eine Gutsherrschaft umfasste:
- Einen Gutshof oder auch mehrere Gutshöfe, die entweder selbstbewirtschaftet oder an Gutspächter verpachtet waren.
- Zu jedem Gutshof gehörten eine Anzahl von sogenannten Hufen. Das waren ansehnliche bäuerliche Stellen mit etwa 30 bis 40 ha und mittlerem, zum Teil gutem Boden. Diese bäuerlichen Stellen sind durch Generationen hindurch an bestimmte Familien in Zeitpacht verpachtet.
- Ferner gehörten zu jedem Gutshof eine Reihe von Instenstellen, auf denen die Gutsarbeiter wohnten. Zum Teil hatten sie ein paar Morgen Ackerland (Landinsten), zum Teil hatten sie nur einen Garten (Hofinsten).
Diese drei Bestandteile: Gutshof, Hufenstellen und Instenstellen bildeten zusammen eine historische wirtschaftliche Einheit, die adlige Gutsherrschaft, in der der Gutsherr oder seine Verwaltung regierte und die Hufner und Insten dienten.
Das Herrenhaus in Klamp
„Ein ländlich derber aber charaktervoller, breit wie ein Bauernhaus gelagerter Bau ist das Herrenhaus Klamp. Die einstöckige Fassade über hohem Kellergeschoss gegliedert durch gedrungene Pilaster zwischen jeder Fensterachse, passt sicht großartig der flachen Muldenlandschaft an.“ So beschreibt Peter Hirschfeld das spätbarocke Gutshaus in seinem Buch Herrenhäuser im Kreis Plön.
Ein Brief von 1739 des Barons Otto Stael von Holstein, des Beauftragten der Gräfin Taube für den Ankauf von Gütern in Holstein,
nennt das Baujahr:
„Ich habe in Vorschlag, so itzo mitfolget, daß Gut Pancker und Clamp, welches Zwey Güther, doch zusammengräntzen, daß letzte ein schön steinern Hauß, so vor 2 und 3 Jahren gantz aus dem Grunde über die Erde mit gewölptem Keller neu gebauet ist.“
Also muss das Gutshaus 1736/1737 erbaut sein und wurde somit unter der Herrschaft Hans Graf zu Rantzau errichtet. Der damalige Pächter war offenbar Bendix Henning Niemann. Das Gut war immer verpachtet und nicht Wohnsitz der Besitzer.
Am 27. April 1807 wurden die reetgedeckten Hofgebäude ein Raub der Flammen, wurden aber rasch wieder aufgebaut. Nur das steinerne Gutshaus wurde von der Feuersbrunst verschont.
Das Gut hat zu Zeiten der Napoleonischen Kriege 1813 durch Durchmärsche und Einquartierungen gelitten.
Es hat sicher in Klamp vor dem jetzigen Herrenhaus bereits ein Wohnhaus gegeben. Es ist aber wohl anzunehmen, dass sich dieses nicht wesentlich von einem Fachwerkbauernhaus unterschieden hat.
 Gut Clamp (Adelige Güter in Holstein 1850)
Gut Clamp (Adelige Güter in Holstein 1850)
1857 Theophile zu Klamp, 1869 C. Theophile, 1897 Hermann Lühr, 1922 Wilhelm Dralle, 1958 Karl August Busch, heute H. u. C. Busch.
Die „Topographie der Herzogthümer Holstein von Johannes von Schröder“ beschreibt 1855
„Das Gut Clamp steht in der Landesmatrikel für 3 Pflüge. Gesamtes Areal 1863 Tonnen a 240 Quadratruthen. Der Boden ist grandig und die Wiesen sind zum Theil moorig. Auf der Feldmark war ein Grabhügel, der abgetragen ist. Gutsmeierei, Kuhhaus, Pferdestall, 2 Scheunen, 24 Pferde, 136 Rinder, 1 Arbeiterwohnung dicht beim Hofe. Das ganze Gut ist zur Vogelsdorfer Mühle zwangspflichtig.“
Der Pflug war ein Flächemaß. Es wurde die Menge Saatkorn zur damit zu bestellenden Fläche ins Verhältnis gesetzt.
1 Pflug = 2 Tonnen Saatgut = 8 Tonnen Hartkorn-Aussaat
1 Tonne Land (Steuertonne) = 5466,06 m²
1 Quadratrute = 21,02 m²

Gutshaus Klamp (Ansichtskarte um 1900)
Besitzer Gut Klamp
- 1416 Feldmarschall Schack III von Rantzau (Vater: Wulf von Rantzau)
- 1469 Claus von Rantzau (Sohn von Schack)
- 1543 Claus von Rantzau (Sohn von Wulf)
- darauf dessen Sohn Andreas Rantzau
- 1587 Claus Rantzau
- Am Ende des 16. Jahrhunderts ward dieses Gut gerichtlich verkauft, und 1594 war Heinrich Rantzau Besitzer
- Januar 1598 Heinrich Rantzau zu Klamp verkauft Hof und Gut Klamp an Paul Rantzau zu Brodau und quittiert ihm über 29.000 Mark lübisch.
- 1630 dessen Wittwe Lucia Rantzau
- 1. Mai 1640 Dorothea von Ahlefeldt (1586—1647), Witwe des Detlev Rantzau (1577—1639), verkauft ihrem Schwiegersohn Bartram Reventlow (1611—1666) ihre Güter Panker und Klamp mit den Dörfern Gadendorf, Darry, Wentorf, Vogelsdorf und Daventze sonstigem Zubehör, mit allen Lansten (Pächter), Hufnern, Wurtzetteln (Wurt = Hausstelle mit Kohlgarten die von landarmen Nachsiedlern bewirtschaftet wurde) und Kätnern (Kleinbauer, der keinen Anteil an den Gemeinheiten hatte) für 67 000 Reichstaler.
- 1663 Bartram und Christina Reventlow geb. Rantzau (1618—1688) verkaufen dem Generalmajor Hans Rantzau zu Erbkauf ihre Höfe und Güter Panker und Klamp mit allen dazu belegenen Dörfern, als Gadendorf, Darry, Wentorf und Vogelsdorf, so nach Panker gehören, und das niedergelegte Dorf Daventze, so dem Hoffelde zu Klamp einverleibt, doch ausgenommen die drei Pflüge oder Hufner zu Martensrade, die Verkäufer von Detlef Rantzau zu Helmstorf gekauft hat, und acht namentlich genannte Personen, von denen eine bei Verkäufers Sohn, dem Rittmeister Otto Reventlow, sich aufhält, mit allem Zubehör, insbesondere dem Kompatronat der Kirche zu Lütjenburg, den nach Panker gehörenden Gestühlen und dem an der Kirche aufgemauerten sog. Pankerschen Begräbnis für 50 000 Reichstaler in specie.
- 15. Mai 1690 Christopher Rantzau verkauft seinem Bruder Detlef die vom Vater ererbten Güter und Höfe Panker, Klamp und Vogelsdorf mit allem Zubehör, insbesondere dem Begräbnis zu Lütjenburg für 68 000 Reichstaler in specie. Detlef tritt in die Verpflichtungen seines Bruders ein und zahlt dessen Gläubiger im Umschlag 1691 aus, über den Rest erhält Christopher eine Obligation. Sofortiger Antritt, der Holländer Wintter verbleibt in seinem Vertrag, drei genannte Leute soll der Verkäufer noch entlohnen. Bestimmungen über Betten, Haugerät, Ziegelei-Einkünfte, einen Freigelassenen. Der Verkäufer bleibt bis Jacobi in Panker wohnen und darf bis dahin die Pferde benutzen
- 1741 wurde das Gut an die Gräfin Hedwig Ulrike v. Taube verkauft „… die auf 31 Pflüge stehenden Güter Panker und Klamp samt dem Meierhof Vogelsdorf, mit allem Zubehör, insbesondere dem Kompatronat an der Kirche zu Lütjenburg von Guts Panker wegen, für 88 000 Reichstaler in specie.“ und seitdem hat es mit Panker denselben Besitzer gehabt
Wentorf, Vogelsdorf, Rönfeldholz
1821 gab es in Klamp eine Serie von Brandstiftungen - der ganze Hof Vogelsdorf, 2 Halbhufnerstellen in Vogelsdorf, eine Scheune in Wentorf und die Schulscheune brannten nieder - die Täter sind nicht ermittelt worden.
Mühlen in Vogelsdorf
Der erste Nachweis einer Mühle in Vogelsdorf ist 1622 mit einem Eintrag im Kirchenrechnungsbuch von Lütjenburg überliefert.
„Kirchgeschworener … erwehlet auf der Junckern seiten aber von jeglichem Compatronen von dero Unterthanen einer, alß Detleff Krüger in der Walck Mühlen, aus dem Gute Pancker …“
Auch die Art der Mühle geht aus einem Eintrag von 1634 hervor. „Der Pastor hat jährlich zu haben wie folget … so hat er den ganzen Papenkamp vom rothen Thore biß an die Walck Mühle …“
Zum Betrieb der wasserbetriebenen Walkmühle wurde die kleine „Bäk“ (auch „Lütt Elv“ genannt) zu einem Mühlenteich aufgestaut. Bei Walkmühlen wandelt eine besondere Mechanik die drehende Bewegung des Wasserrads in eine stampfende Auf- und Abbewegung um. Sie reinigen Materialien wie Tuch oder Leder. Vor allem verdichten sie gewebte Wollstoffe zu Loden.
1634 starb Detleff Krüger „An des verstorbenen Kirchgeschworenen Detleff Krögers stete von dessen adelichen Obrigkeit zum neuen Kirchgeschworenen ist praesentirt, Paul Nippe zu Vogelsdorf.“ und wir erfahren auch gleichzeitig den Namen seines Nachfolgers.
Ab 1759 war die Familie Bömcker Pächter der Mühle. Der letzte Bömcker starb 1763 ohne Erben. Er ist „… in der Stille beigesetzet.“
Ist aus der Bestattungsart der wirtschaftliche Verfall abzulesen? 1769 hat man sich jedenfalls in Panker entschlossen, die Walkmühle nicht wieder zu besetzen, sondern an ihrer Stelle eine Kornmühle zu errichten.
„Die Walkmühle, so verfallen und an deren Statt diesen Sommer eine neue Kornmühle gebauet, ist noch nicht völlig fertig …“
Das Korn unserer Ortschaften wurde ursprünglich in der Helmstorfer Mühle gemahlen. Zur neuen Mühle Vogelsdorf waren nun zwangsverpflichtet die Höfe Klamp und Vogelsdorf und die Dörfer Wentorf, Vogelsdorf und Rönfeldholz, sowie das Dorf Darry.
Der erste Kornmüller 1769 war Hans Jochim Pott. 1777 übernahm der erste Angehörige der Familie Kortum die Pacht der Mühle. Die Familie Kortum hat in Folge 200 Jahre der Vogelsdorfer Mühle die Treue gehalten. 1787 erhielt Hans Detleff Kortum vom Fürsten Friedr. Wilh. von Hessenstein die Genehmigung, auf eigene Kosten ein Windmühle zu bauen:
„Erlauben Ihre Durchlaucht dem Müller Kortum, daß er aus seinen Mitteln und ohne das mindeste Zutun der Herrschaft oder Beihilfe einiger Hand- und Spanndienste, eine Windmühle auf dem ihm anzuweisenden Platze, ohne eine mehrere Häuer zu entrichten, erbauen mag, um sich solcher bei Mangel des Wassers bedienen zu können.“
Der Bau der Windmühle war notwendig, weil es wohl oft vorkam, daß die kleine „Bäk“ nicht genug Wasser zum Betrieb der Wassermühle führte. Nach dem Pachtvertrag konnten die Zwangsgäste in einem solchen Fall ihr Korn wieder abholen und an anderer Stelle mahlen lassen, wenn es drei Tage in der Mühle gelegen hatte.
Eine solche Mühle hatte einen hohen Wert. Im Jahre 1808 hatte die Windmühle einen Versicherungswert von 2.000 Reichsthaler, die Wassermühle nur von 480 Reichsthaler.
Einige Angaben aus dem ersten erhaltenen Pachtvertrag von 1788:
Die Pachtung ist abgeschlossen auf 20 Jahre. Die Häuer beträgt 94 Reichsthaler. Mahllohn ist „… die gewöhnliche Matten, nämlich der 16. Teil von der Tonne.“
Steine und Eisenzeug mußte der Pächter alleine beschaffen, sie waren sein Eigentum; die Pächter von Panker, Klamp und Vogelsdorf waren verpflichtet, neue Steine unentgeltlich von Kiel oder Lübeck zu holen.
„Ist Häurer schuldig und verbunden, auf Maitag 1788 eine Waage mit richtigem Gewicht auf seine Kosten in der Mühle anzuschaffen und zu halten und muß auf jedem Gewicht die Zahl der Pfunde mit deutlicher Ziffer zu sehen sein, damit jeder der etwas zur Mühle bringet, sein Korn sowohl beim Hinbringen, als das Mehl hernach beim Wegholen nach eigenem Gefallen wägen kann.“
Am 1.7.1854 wurde das Mühlenzwangerecht in Holstein aufgehoben.
Im Juli 1900 brannte auch die Windmühle ab und wurde nicht wieder aufgebaut. Das Plöner Wochenblatt schrieb darüber:
„In vergangener Nacht von halb 11 an überzogen an einem überaus heißen und schwülen Tage unser Stadt mehrere Gewitter. Kurz nach 12 Uhr kam ein sehr harter Schlag und stand auch nach diesem die in nächster Nähe gelegene Vogelsdorfer Mühle in hellen Flammen.“
Die Mühle war außen ganz mit Reet gedeckt und muss ungeheure Hitze ausgestrahlt haben. Die Feuerwehr konnte sich mit ihren Handpumpen nur auf den Schutz der Nebengebäude beschränken. Die Mühle wurde nicht wieder aufgebaut, den Mühlenberg trug man ab.

Standort der Windmühle

Auffahrt zur Windmühle (Ansichtskarte um 1900)
Im Jahre 1832 wurden das Wohnhaus mit Wassermühle und die Scheune neu gebaut. Die heutigen Gebäude sind im Kern also fast 150 Jahre alt. Der Neubau war notwendig geworden geworden, weil das gesamte Anwesen am 20.3.1832 niedergebrannt war. Das Feuer war in der Scheune ausgebrochen; zwar herrschte nur schwacher Wind, dieser stand aber auf das Wohnhaus zu. Das Mühlengehöft brannte so schnell nieder, daß nur einiges Bettzeug und vier Schafe gerettet werden konnten. Es handelte sich um Brandstiftung, und es auch wurde auch sehr bald ein junges Mädchen aus Vogelsdorf verdächtigt, daß wenige Tage vorher in der Mühle beim Diebstahl von ein Paar Stiefeln ertappt worden war.

Verzeichniss der im Herzogthum Holstein in Verhaft gewesenen Verbrecher, Jahrgang 1833, Seite 36
Die Mühlengebäude sind heute nicht mehr Pachtung, sondern wie die Bauernstellen Eigentum geworden. Im Jahre 1935 stellte Freidrich Kortum die Wassermühle auf Elektrobetrieb um. Das Wasserrad wurde entfernt und der Mühlenteich wurde abgelassen. Der kleinen „Bäk“ — 1765 hieß der Bach „Walckbeek“ — sieht man nicht an, daß sie viele Jahrhunderte dem Menschen mit ihrer Kraft gedient hat.
Heute ist der Mühlenbetrieb ganz eingestellt. 1979 wurden die Gebäude zu Ferienwohnungen umgebaut.
Schmiede Wentorf
Am 1. Oktober 1744 verlobte sich "Andreas Schneider, Schmid in Wendorff", so ist es im Trauregister der Stadt Lütjenburg aufgeführt. Diese Eintragung ist die erste gesicherte Nachricht einer Schmiede in Wentorf. Aus der Appunktation (schriftliche Fixierung der Einzelheiten eines Kaufvertrages) von 1739 zum Verkauf der Güter Panker und Klamp - die denselben Herrn hatten - geht hervor, daß es in diesen Gütern auch vorher schon einen Schmiede gab. Es heißt dort unter Abschnitt Drittens:
"Jedoch hat der Schmit Claus Jochim Hamann so lange seine Frau Elsabe lebet, die Schmiede, und dazu gehörigen Hause und Wiese, gegen Erlegung der jährlichen 1o Reichsthale Miethe weit geruhiglich, so lange er tüchtige Arbeit verfertiget, zu nutzen."
Leider läßt sich aus den Kirchenregistern nicht feststellen, in welchem Gut Hamann gewohnt hat. Manches spricht dafür, daß er der Schmied im Gute Klamp war.
Der Schmied Hinrich Andreas Schneider hat 1734 schon in Wentorf gelebt; er war 1734, 1739 und 1741 Pate bei Taufen. Er wird in dieser Zeit in einer bestehenden Schmiede - bei Claus Jochim Hamann? - als Geselle gearbeitet haben. Schneider war wie alle folgenden Schmiede nicht leibeigen. Als er 1763 starb, muß er recht wohlhabend gewesen sein. Für seine Beerdigung war an Glockengeld (Gebühr für das Läuten, besonders bei Beerdigung) 12 Schilling (normal war 8 Schilling) gezahlt worden, außerdem für "Geridons" (Kerzenhalter mit Kerzen, deren Aufstellung damals extra bezahlt werden mußte) 6 Schilling, im allgemeinen wurde darauf verzichtet. Mit dem Tode des H. A. Schneider verschwindet die Familie Familie Schneider wieder aus den Kirchenbüchern.

1767 finden wir einen Schmied Claus Lamp in Wentorf. Die Eintragungen in den Kirchenregistern erzählen von traurigen Ereignissen im Hause Lamp: 1767, 1768, 1771 und 1775 trug der Vater jeweils ein totgeborenes Kind auf den Friedhof. Mit diesem Claus Lamp ist kurz vor seinem Tode ein Pachtvertrag abgeschlossen worden; es ist der erste erhaltene Pachtvertrag der Schmiede Wentorf. Die Jahreshäuer betrug 20 Reichsthaler. Dafür sollte ihm die Schmiede
"samt Zubehör, denen dabey befindlichen Koppeln und Kohlhöfe auf seine, seiner Frau und jetzigen Kinder Lebenszeit" überlassen werden, "im fall er sich und seine Kinder ordentlich betragen und sowohl die Hof als Unterthanen Arbeit gut und tüchtig machen, auch niemand übersetzen"
Vom Hoftag (Arbeit auf dem Gutshof) war Lamp befreit, unterlag aber der Gerichtsbarkeit des Gutes; er mußte sich "mit dem im hiesigen Gerichte gethanen Ausspruch ohne Appellation begnügen, auch die etwanigen Gerichtskosten ohne Widerrede bezahlen". Interessant ist die Übereinstimmung der Pachtdauer mit dem schon erwähnten Zusatz aus der Appunktation von 1739. Auch dort war festgelegt,daß die Pachtzeit sich nicht nur nach der Lebenszeit des Schmiedes, sondern auch der seiner Frau richtet. Elsabe wird die Frau oder Tochter eines früheren Schmiedes gewesen sein, mit dem ein ähnlicher Vertrag abgeschlossen worden war, während Hamann in die Schmiede eingeheiratet hatte.
Claus Lamp starb 1780 im Alter von 52 Jahren; er hinterließ drei Töchter und einen Sohn Claus Jürgen Hinrich. Die Witwe heiratete 1781 wieder, einen Schmied Clas Friedrich Holtmann, Sohn eines Trabanten in fürstl. eutinischem Dienst. Bei der Verheiratung wurde festgelegt, "die Mutter nebst dem Stiefvater giebt den Kindern die nöthige Kleidung und Unterhalt, bis sie zum hl. Abensmahle gewesen sind, umsonst, hält dieselben auch zur Schule".
Oft begegnen uns in den Kirchenregistern die Namen anderer Schmiede in Wentorf. Anscheinend hat der Pächter der Schmiede immer soviel Arbeit gehabt, daß die Anstellung eines oder mehrerer Gesellen erforderlich war. Noch 1853 klagt das Schmiedeamt Lütjenburg, "daß die Gutsschmiede der Umgegend in der Regel mit 3-4 Gehilfen arbeite während die hiesigen Grobschmiede zuweilen nicht einen einzigen Gesellen halten." Bis zum Erlaß der Gewerbefreiheit 1867 waren das Gut Klamp, der Meierhof Vogelsdorf und die Hufner in Wentorf und Vogelsdorf zu der Schmiede in Wentorf zwangsverpflichtet.
1803 wurde der Sohn des 1780 verstorbenen Claus Lamp, Claus Jürgen Hinrich Lamp, 31 Jahre alt, entsprechend dem Vertrag von 1779 Pächter der Schmiede. Er hatte bei einem zünftigen Meister gelernt, also nicht bei seinem Stiefvater. Schmiedemeister in den Schutzzonen um die Städte durften nicht den städtischen Zünften angehören. Von nun an blieb die Schmiede, bis auf eine kurze Zwischenzeit, in der Familie Lamp bis zu dem Unglücksfall im Jahre 1911. In der Nacht vom 15. zum 16. März 1911 erstickten der Schmied Gustav Friedrich Lamp, 24 Jahre alt, und das Dienstmädchen Luise Herbst, noch Schulkind 13 Jahre alt, an Kohlenmonoxydgasen, die vom Wohnzimmer durch die Türritzen ins Schlafzimmer gesickert waren. Obwohl sofort mit Pferd und Wagen eine Sauerstoffflasche von Plön geholt wurde, konnten der Schmied und das Mädchen nicht mehr ins Leben zurückgerufen werden. Frau Lamp erwachte wieder aus der Bewußtlosigkeit; sie hatte in der Nähe des Fensters geschlafen. Nach diesem Unglück übernahm Friedrich Schumacher aus Panker die Schmiede, die er bis zu seinem Tode 1964 führte. Im Jahre 1924 wurde die Schmiede im Rahmen der Aufsiedlung von Wentorf, Vogels- dorf und Rönfeldholz Eigentum des bisherigen Pächters. Heute (1981) ist der Sohn Gustav Schumacher der Besitzer der Schmiede.

Von der wohl ersten Schmiede in Wentorf gibt es eine Beschreibung im Inventarium des Gutes Klamp aus dem Jahre 1769:
"das Schmits Haus Ist 4 Fach lang, von Leimwänden, an Dach und Fach in brauchbarem Stande. In diesem Haus ist ein Zwirbogen (= Schwibbogen) ohne Darre. In der Stube ist ein Ofen von Mauersteinen, auch 7 Fenster, wovon ein mit einem Rahmen, Beschlag und Hengen und 6 Fenster genagelt. Die Schmiede, so 3 kleine Fach lang, wovor eine Thüre mit eisernen Hengen, haken und Überfall, ist mit Dachpfannen behängt, überhaupt in baufälligem Zustande, soll etwas reparirt werden, damit selbige noch einige Jahre stehen könne. Die Scheune ist alt und baufällig, wovor eine alte zerbrochene Thüre, muß bald neu gebauet werden."
Die heutigen Gebäude stammen aus dem vorigen Jahrhundert. Das Wohn- haus wurde 1846 erbaut, die Schmiedewerkstätte war ein Jahr vor- her errichtet worden. 1931 wurde an die Werkstatt die Scheune angebaut.
Für kurze Zeit hat es auch in Vogelsdorf eine Schmiede gegeben. 1778 errichtete die Gutsverwaltung Panker diesen Betrieb. Sofort erhoben Magistrat und Schmiedeamt Lütjenburg Protest. Panker versuchte, von Kopenhagen zur Stellungnahme aufgefordert, in einer Gegendarstellung die Schmiede zu halten. König Friedrich VII. entschied, daß die Schmiede entsprechend der Verordnung von 1711 wieder aufzuheben. Panker ließ sich Zeit damit; 1792 gab es noch einer Kleinschmied in Vogelsdorf.
Schule Wentorf
Wann genau zum ersten Mal Schulunterricht in Wentdorf abgehalten wurde läßt sich nicht ermitteln; es mag aber vor 1700 gewesen sein. Häufig hatte der Adel am Ende des 17. Jahrhunderts Volksschulen errichtet, da die „Kirchspielschulen sich als unfähig erwiesen haben, der weiten Schulwege des platten Landes Herr zu werden.“ Die älteste Nachricht über eine Schule in Wentorf findet sich im Sterberegister der Kirche Lütjenburg. „23.3.1724 Kordt Bullerkist v. Wentorf Schulmeister ein alter Mann zur Erden bestattet.“ Wie lange Bullerkist gewirkt hat und ob es vor ihm schon andere Schulmeister gab ist nicht bekannt, sein Nachfolger allerdings schon. „23. Juni 1726 Des Schulmeisters Reimers von Wentorf kleinen Sohn zu Grabe getragen …“
Aus dem Inventarium zur Pachtübergabe des Hofes Klamp im Jahre 1769 erfahren wir, wie das Schulhaus des Reimers — vermutlich das erste Schulhaus in Wentorf überhaupt — ausgesehen hat: „Das Schul-Haus ist 3 Fach lang (also etwa 9 m), von Leimwänden, an Dach und Fach in schlechtem Stande, die auswendige Tür mit Hengen und ein überfall, die inwendigen Türen sind auch mit eisernen Hengen und überfällen. In der Stube sind 8 Fenster, wovon ein mit einem Rahmen und Beschlag, die übrigen 7 aber festgenagelt sind. Der Ofen ist von Mauersteinen und der Fußboden von Lehm. In diesem Hause ist ein Zwirbogen.“
Sicher ist das Haus nicht als Schulhaus gebaut worden, man nahm eine vorhandene Hirten- oder Handwerkerkate. Aus der Beschreibung der Kate ist nicht zu ersehen, wie sie drinnen eingeteilt war. Vermutlich gab es nur eine Diele mit der Feuerstelle dem Schwibbogen, und eine Stube. In dieser Kate lebte der Schulhalter mit seiner Familie. Hier übte er sein Handwerk aus, denn vom Schulehalten konnte er sich und seine Familie nicht erhalten. Es waren wahrlich wenig erfreuliche Arbeits- und Wohnverhältnisse. Von einem geregelten Unterricht in heutigem Sinne kann natürlich nicht gesprochen werden. Ein Teil der schulfähigen Kinder wird die Schule auch nie von innen gesehen haben.
Eine neue Schule wird gebaut
In Wentorf trat der erste seminaristisch gebildete Lehrer, Andreas Detlefsen, am 25. Februar 1820 seinen Dienst an. Er war vorher ein Jahr in Panker Privatlehrer gewesen, wo er die Kinder der landgräflichen Bediensteten unterrichtet hatte.
Lehrer Detlefsen begann seinen Dienst in einer neu erbauten Schule. Der Neubau war notwendig geworden, weil die alte Kate weder den Bestimmungen des Cismarschen Regulativs noch der Allgemeinen Schulordnung entsprach. Die Verwaltung in Panker hatte selbst erkannt, daß das alte Schulhaus von 1778 seinem Zweck nicht mehr gerecht werden konnte. In den Bauvorschlägen für das Jahr 1812 wurde festgestellt: „Die Reparation am Schulhause ist sehr nothwendig, das ganze Haus ist aber zu klein, und zum Schulhaus schlecht eingerichtet.“
Das neue Schulhaus wurde in den Jahren 1819/20 „außen vor Wentorf“ erbaut; gleichzeitig wurde das Land für den Lehrer in unmittelbarer Nähe des neuen Hauses ausgelegt. Die feierliche Eröffnung der neuen Schule fand am 25. Februar 1820 statt. „Es wird der Dorfschaft Wentorf hiermit bekannt gemacht, daß morgen den 25ten dieses Monats Vormittags 9 Uhr die förmliche Einführung des Schullehrers Detlefsen in die neu erbaute Schule statthaben wird, wo sich alle schulfähigen Kinder einzufinden haben, auch die Familien Väter Antheil nehmen können." Das neue Schulhaus hatte noch nicht ganz die heutige Größe, war aber für seine Zeit recht aufwendig gebaut. Man vergleiche das Taxationsprotokoll der neuen Schule mit der Beschreibung des nur um 42 Jahre älteren Schulhauses in Wentorf. „Ein ganz neu erbautes Schulhaus von Brandmauer aufgeführt, das Dach mit Schoof gedeckt ein Etage hoch, und ein Keller unter einem theil des Hauses, es befinden sich im Hause siben Stück Hitzbare Stuben, alle mit bretternen Fußboden, wovon zwey Wohnstuben gibsdecken haben, drey Kammern, eine Küche.“ Zu dem Schulhaus wurde gleichzeitig eine Scheune gebaut, die noch im gleichen Jahr durch Brandstiftung abbrannte; sie wurde sofort durch einen Neubau ersetzt. Diese Scheune brannte 1908 ab; an ihrer Stelle wurde 1909 ein kleiner Stall gebaut.
Schulordnung und Schulpflicht
Beurlaubungen (Dispensationen) für die Feldarbeit während der Sommermonate durfte der Pastor aussprechen, der dabei „auf den in den ersten Jahren bewiesenen Schulfleiss Rücksicht nehmen“ sollte. Der Schulbesuch blieb noch viele Jahre schlecht. 1828 lesen wir in der Schulchronik: „Als ich im Jahre 1828 die Schule übernahm, waren 112 schulpflichtige Kinder im Schuldistrikt. Nur wenige besuchten im Sommer die Schule; die meisten Kinder verließen Ostern die Schule und kamen erst im November wieder.“ Viel besser war es auch 1849 noch nicht um den Besuch der Sommerschule bestellt. Ein Visitationsbericht aus diesem Jahr beginnt: „In Wentorf waren von 140 Kindern 44 gegenwärtig.“ Dabei wurde dieser Zustand nicht besonders gerügt; es wurde lediglich festgestellt, wie ja nicht anders zu erwarten war: „Die Kinder waren aber in der geistigen Entwicklung und im Wissen zurück, was wohl hauptsächlich darin seinen Grund hat, daß dieselben die Schule noch nicht wieder besucht hatten.“ 1878 übernahm der Lehrer Claus Heeschen die Schule Wentorf; auch er klagte noch über den schlechten Schulbesuch. Die Beurlaubungen wurden jedoch in den folgenden Jahren seltener. 1897 schreibt Lehrer Lembke: „Die Dispensationen sind jetzt fast gänzlich verschwunden. Nur ein Knabe wurde für einen Monat dispensiert.“
Die Schulordnung von 1814 regelte die Schulpflicht. Danach sollten vom 6. spätestens vom 7. Lebensjahr bis zur Konfirmation alle Kinder die Schule besuchen. In den deutschen Schulen soll der Vortrag des Lehrers und überhaupt der ganze Unterricht in der Hochdeutschen Sprache ausschließlich geschehen. Für den Lehrer gab es in der Schulordnung einige wichtige Bestimmungen, die seinem Stand eine bessere soziale Stellung verschafften. Das schon in der Schulordnung von 1745 ausgesprochene Verbot der Entlassung von Lehrern durch den Gutsbesitzer und Patron der Schule wurde 1814 erneuert und auf die Unterlehrer ausgedehnt. Alle Lehrer, auch die seminaristisch ausgebildeten mußten sich vor ihrer Anstellung einer Prüfung durch den Propsten unterziehen. Die Schulordnung regelte auch die Besoldung neu. Neben freier Wohnung, Schulland und Naturallieferungen war ein festes Gehalt zu zahlen von „48 bis 160 Rbthl. und darüber, nach Verhältnis der Größe und des Wohlstandes des Schuldistrictes.“ Für den Lehrer in Wentorf waren im Cismarschen Schulregulativ 60 Rbthl. oder 96 Mark lübisch bar festgesetzt, der Unterlehrer sollte nach der gleichen Verordnung 40 Rbthl. erhalten. Wentorf gehörte damit wohl nicht zu den wohlhabenden Schuldistrikten.
112 Schulkinder lebten im Schuldistrikt, als Lehrer Krützfeld die Schule Wentorf übernahm. Da jedoch der größte Teil der Kinder nur im Winter die Schule besuchte, genügte im Sommer ein Lehrer. Im November wurde jeweils ein „Gehülfe“ angestellt, der im allgemeinen jährlich wechselte. Als die Schülerzahl auf 160 angewachsen war, beantragte der Schulinspektor Pastor Groth in Lütenburg, „es möge fortan ein seminaristisch gebildeter Lehrer für die Elementarklasse fürs ganze Jahr angestellt werden.“ Gegen den Widerspruch des Oberinspektorats Panker entschied das Visitatorium für den Antrag.
Nach der Schulordnung hatte der 1. Lehrer seinen Kollegen zu beköstigen und zu besolden, wofür ihm „eine billige, den Ausgaben angemessene jährliche Vergütung zu geben sei.“ In Wentorf erhielt Krützfeld dafür 110 alte Thaler, die in 70 Thaler Gehalt und 40 Thaler Vergütung für Unterkunft und Verpflegung aufzuteilen seien. Der Lehrer Krützfeld hat der Schule Wentorf 50 Jahre gedient.
Die Schulbücher aus dänischer Zeit wurden 1868 aus den schleswig-holsteinischen Schulen verbannt. 1869 wurden Wochenstunden und Ferien neu festgesetzt: In der Woche mindestens 26 Stunden (excl. Turnen), höchstens 32 (incl. Turnen), und zwar vormittags 3-4 Stunden, nachmittags außer mittwochs und sonnabends 2-3 Stunden. Schulferien: Vom 24. 12.-1. 1., von Mittwoch vor Ostern bis Mittwoch nach Ostern, Bußtag, Himmelfahrtstag, Pfingstsonnabend, Pfingstdienstag, Geburtstag des Königs, der Nachmittag vor den Schulprüfungen und 27 Tage Ernteferien.
Am 11. 3. 1872 trat das Schulaufsichtsgesetz in Kraft. Zuvor lag die Schulaufsicht in den Händen der kirchlichen und kommunalen Träger. Praktisch änderte sich zunächst nichts, denn eine Woche später wurden alle Propstei- und Lokalschulinspektoren in ihrem Amt bestätigt.
Am 15. Oktober 1872 wurde der unterrichtliche Teil der allgemeinen Schulordnung von 1814 aufgehoben. In den neuen „Allgemeinen Bestimmungen“ gab es Listen der „unentbehrlichen Lehrmittel“; die Beschaffung wurde kontrolliert. „Für den vollen Unterricht sind erforderlich: je ein Exemplar von jedem in der Schule eingeführten Lehr- und Lernbuche, ein Globus, eine Wandkarte von der Heimatprovinz, eine Wandkarte von Deutschland, eine Wandkarte von Palästina, einige Abbildungen für den weltkundlichen Unterricht, Alphabete weithin erkennbar auf Holz- oder Papptäfelchen geklebter Buchstaben zum Gebrauch beim ersten Leseunterricht, eine Geige, Lineal und Zirkel, eine Rechenmaschine.“
In Wentorf war vom Kauf der Geige abgesehen worden, da der Lehrer „zum Geigenspiel nicht befähigt“ sei. Das Amt Cismar war damit einverstanden. Die Gutsherrschaft Panker wurde aber verpflichtet, für Wentorf noch einige Bilder für den weltkundlichen Unterricht anzuschaffen. (Leider ist nicht bekannt, was für Bilder beschafft wurden.) Die allgemeinen Bestimmungen brachten neue Richtlinien für jedes Unterrichtsfach. 1880 wurde ein Turnplatz eingerichtet mit einem Reck, zwei Barren, einem Querbaum und einem Sprunggestell mit Sprungbrett.
Kindervogelschießen
1878 trat Lehrer Heinrich Heeschen seinen Dienst in Wentorf an. Er spricht 1882 erstmalig von einem Kindervogelschießen; er erwähnt es nicht als Neueinführung, sondern am Rande als Selbstverständlichkeit. Das Vogelschießen der Schule Wentorf ist also über 90 Jahre alt. Ist dieser Brauch vielleicht aus einem Erwachsenenfest herausgewachsen? Am Anfang des 19. Jahrhunderts scheint ein solches Fest in unseren Dörfern üblich gewesen zu sein. In einem Rapport des Gutsschreibers Stellwag in Panker heißt es am 8. 6. 1810: „Dem Krüger Knuth zu Gadendorf wurde auf sein Ansuchen erlaubt am 24ten dieses Monats das gewöhnliche Lustvogelschießen zu halten, jedoch mit der Verwarnung, daß nichts Polizeiwidriges geschehe.“
Bis 1951 war das Schulfest - mit Unterbrechungen - ein richtiges Vogelschießen, das heißt, es wurde mit einer selbstgefertigten Armbrust auf einen Vogel geschossen. Dieser wurde auf einem 4-5 m hohen Pfahl befestigt; dahinter waren Laken angebracht zum Auffangen der Bolzen. Die Entfernung der Schützen betrug etwa 7-8 m. Die Bolzen wurden ebenfalls von den Jungen selbst aus Holunderzweigen gefertigt; sie waren am vorderen Ende zur Beschwerung mit Blei ausgegossen. Es galt nun, den Vogel stückweise herunterzuschießen. Dabei hatten die verschiedenen Teile des Vogels ihren Preis, der abends beim Tanz ausgehändigt wurde. Die kleinsten Preise brachten die „Flattern" vier in den Rumpf ein- gesteckte Stäbe mit kleinen runden Scheiben. König wurde, wer den Rumpf abschoß. Es wurde meist den ganzen Tag nach dem Vogel geschossen. War der Rumpf bis zum Abend nicht gefallen, wurde er eingesägt, damit er leichter zerfiel. Am Abend wurde getanzt, ursprünglich auf dem Speicher des Hofes Klamp (oder auf einer Bauerndiele?), ab 1899 in einem Zelt, das für den Gildetag der Wentorfer Totengilde aufgestellt wurde. Das Vogelschießen der Schule Wentorf fand daher immer drei Tage nach dem Gildefest statt; dieses war - ab 1853 nachgewiesen immer am 2. Sonntag nach Pfingsten. Seit der Saal 1925 in Rönfeldholz gebaut worden ist, schloß das Vogelschießen dort mit einem Erwachsenenball ab. Es war dann auch nicht mehr mit dem Termin vom Gildetag abhängig.
Platzhalter für Kindervogelschießen: Ablauf? Welche Preise gab es?
Schwere Jahre
… brachten die beiden Kriege über die Schule. Im 1. Weltkrieg mußten oft beide Klassen von einem Lehrer betreut werden. Viel Unruhe werden die vielen Sammlungen in die Schule gebracht haben. Die Erfolgsberichte darüber melden z. B. 1916: 65 Pfd. Knochen, 225 Pfd. Lumpen usw. Viel Zeit wird das Sammeln im Wald gefordert haben: 26 814 Pfd. Frischlaub als Futter für die Pferde 1 Ztr. frisches Laub wurde mit 10 Mark bezahlt, 165 Pfd. Bucheckern, 724 Pfd. Eicheln, 583 Pfd. Kastanien, 122 Pfd. getrocknete Brennesseln.
1918 suchte die Grippe auch unsere Schule heim, zeitweise waren bis zu 80 % der Schulkinder erkrankt. Den nach dem Kriege zurückkehrenden Soldaten hat die Schule eine Ehrenpforte gebaut, die Heimkehrer wurden außerdem in einer von der Schule ausgestalteten Feier begrüßt.
Der zweite Weltkrieg brachte zu den Belastungen durch häufigen Lehrerwechsel noch die Sorge um die Luftangriffe. Kiel ist nahe. Im Ortsteil Rönfeldholz wurde ein Haus durch Bomben zerstört, wobei zwei Kinder starben. Ein Bombensplitter schlug in einer Schulklasse ein Loch in die Wand. Anfang Mai 1945 wurde der Unterricht ganz eingestellt. Die Tieffliegergefahr war schließlich auf dem Lande so drückend geworden, daß es unverantwortlich war, die Kinder auf die Straße und in die Schule zu schicken.
Hinzu kam noch ein weiterer Umstand, weshalb die Schule geschlossen werden mußte: Es kamen Scharen von Flüchtlingen aus den Ostgebieten, die in der Schule untergebracht werden mußten. Es wohnten damals über 70 Personen im Schulhaus. In den Schulräumen war Massenquartier. Jeder baute sich um das Strohlager herum eine Abschirmung aus Decken. Dann nach dem Waffenstillstand wurde unsere Gegend Sperrbezirk. Tausende von Soldaten zogen ein in Scheunen, auf Böden, in Ställe, in Feldscheunen. Die Soldaten wollten tauschen: Zwirn, Stoffe gegen Eßbares. Einer wollte Klavierunterricht erteilen, einer Englisch (gegen Bratkartoffeln). Auf dem Schulhof wurde getanzt nach selbstverfertigten Krach-Instrumenten. Nach einer Angabe in der Schulchronik sind damals 4000 Soldaten in den Ortschaften der Gemeinde Klamp untergebracht gewesen.
Der Schulunterricht wurde in Wentorf in der Grundschule am 1. 12. 1945, in der Oberstufe am 18. 12. 1945 wieder aufgenommen. Mit dem Schulbeginn waren aber noch keineswegs normale Verhältnisse im äußeren wie im inneren Schulbetrieb eingetreten.
Die Zeit nach 1950 scheint in Wentorf - sicher auch in anderen Schulen - gekennzeichnet durch ein besonders fruchtbares Verhältnis zwischen Schule, Eltern und Gemeindevertretung. Die Gemeinde zeigte Verantwortung für ihre Schule und war gerne bereits, für sie finanzielle Opfer zu bringen, aber ein immer größerer Prozentsatz der Kinder besuchte nicht mehr die Schule der Gemeinde, sondern weiterführende Schulen in Lütjenburg. Die Schule im Dorf war nicht mehr die Schule für alle Kinder des Dorfes. Die immer stärker hervortretende Diskussion um Schulreform ließ Investitionen an der weniggegliederten Landschule bald sinnlos erscheinen.
Am 12. 5. 1966 faßte die Gemeindevertretung der Gemeinde Klamp den Beschluß, sich an der Planung einer Dörfergemeinschaftsschule am Stadtrand von Lütjenburg zu beteiligen; es handelte sich dabei noch um ein Projekt im Sinne der kleinen Dörfergemeinschaftsschule des damaligen Kultusministers Osterloh. 1970 schloß sich die Gemeinde Klamp dann dem Schulverband der projektierten Gesamtschule Lütjenburg an. Am 20. 7. 1973 beschloß die Gemeindevertretung, bei dem Kreisschulamt Antrag auf Umschulung der Oberstufe und des 4. Schuljahres der Schule Wentorf in die Grund- und Hauptschule Lütjenburg zu stellen. Dem Antrag wurde stattgegeben. Es blieben in Wentorf noch die ersten drei Jahrgänge der Grundschule bis diese Anfang 1974 auch nach Lütjenburg umgeschult wurden.
Seit dem 4. Februar 1974 gibt es keine Schule Wentorf mehr.
Adolf Baumgarten (* 5.3.1913, † 1999) war ab 1.9.1951 der letzte Schulleiter in Wentorf. Seine schriftlichen Hinterlassenschaften sind das Gerüst dieser Chronik. Besonders das Kapitel Schule Wentorf wurde von ihm - verständlicherweise - sehr umfangreich und präzise behandelt. Die gesamte Niederschrift würde den Rahmen dieser Webseite sprengen und so kann hier nur eine verkürzte, überarbeitete Fassung - Herr Baumgarten möge verzeihen - wiedergegeben werden.
Veröffentlichungen von Adlf Baumgarten (Auszug):
- "Geschichte der Schule Wentorf von 1820 bis zur Auflösung 1974" Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis Plön,1975
- "Bilder aus der Geschichte der Gemeinde Klamp", 1981
- "Carl von Hessen übernimmt die Güter Panker, Klamp, Schmoel und Hohenfelde" Chronik Gemeinde Panker, 1998
Kleinbahn Kirchbarkau-Preetz-Lütjenburg (KPL)
Wir reisen in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und sind von Rönfeldholz zum Gut Klamp unterwegs. Aus Richtung Lütjenburg steigen weit sichtbare Rauchwolken zum Himmel empor und dann kündet auch schon ein lautes Schnaufen den Einzug einer neuen Zeit an. Schwankend und zischend fährt eine mit Blumen und Fähnchen geschmückte Dampflokomotive an unseren staunenden Blicken vorbei, gewährt uns einen kurzen Blick auf das offene Feuer im Kessel und schon rattern Waggons besetzt mit winkenden Menschen ihren eisernen Rythmus in die Landschaft, um dann mit immer leiser werdendem Quietschen hinter der nächsten Kurve zu verschwinden. Blütenblätter wirbeln losgerissen durch die Luft und legen sich auf die Gleise nieder. Es ist der 1. Oktober 1910, der Tag der feierlichen Eröffnung der Kleinbahnstrecke zwischen Preetz und Lütjenburg.
Wer jetzt noch nicht genug Bilder im Kopf hat, dem möge die Streckenbeschreibung des damaligen Verkehrsvereins behilflich sein, die jedem Fahrgast bei der Eröffnungsfahrt überreicht wurde:
„Bei der Ausfahrt aus dem Staatsbahnhof Lütjenburg führt die Bahn auf hohem Damm um die Stadt Lütjenburg herum, rechts Blicke auf die Stadt, links hübsche Aussicht auf das Kossautal mit dem Viadukt der Staatsbahn, das Dorf Schmiedendorf und - nach dem zweiten Wegeübergang - auf den Hof Helmstorf. Nach Überschreitung der Plöner Chaussee Personenhaltestelle Lütjenburg, links auf der Höhe der zur Herrschaft Hessenstein gehörige Meierhof Vogelsdorf. Die Bahn führt in starker Steigung an der Grenze des Lütjenburger Stadtgebiets und der Herrschaft Hessenstein entlang, links die zur Herrschaft gehörigen Gehege Eller und Großholz, recht hübscher Blick auf das große Gehege Stretzer Berg, im Hintergrunde über das Gehege hinweg der Turm des Hessensteins. Hinter dem Hofe Klamp, an dem die Bahn unmittelbar vorbeifährt, tritt die Linie in das Gebiet des Gutes Neuhaus, rechts Blick auf den Turm der Giekauer Kirche, die großen Wirtschaftsgebäude des Hofes Neuhaus und den Selenter See mit der Blomenburg und der Selenter Kirche im Hintergrunde.
Die Bahn, die bisher eine westliche Richtung verfolgte, wendet sich jetzt scharf nach Süden, rechts der Hof Gottesgabe, etwas später links einzelne Häuser (Vörstenmoor), beides zu Neuhaus gehörig. Durch das Neuhäuser Gehege Kuhlenbrook in das Gut Rantzau, wo die Bahn wieder ihre frühere Richtung einschlägt, rechts das Dorf Rantzau, links Meierhof Hohenhof, der tiefliegende Haupthof Rantzau ist von der Bahn nicht sichtbar. Bahnhof Treufeld am Nordende des Gutes Schönweide, rechts Blick auf Bauersdorf, die bewaldeten Höhen liegen dicht am Selenter See, links der zum Gut Lammershagen gehörige Meierhof Friedeburg. Das sich gegen das Winterholz und den Tresdorfer See hübsch abhebende Wohnhaus dient seit diesem Frühling als Erholungsheim für junge Mädchen der erwerbenden Stände. Über große Hofkoppeln des Hofes Lammershagen zur gleichnamigen Haltestelle, rechts Blick auf den freundlich gelegenen Hof, über den hinweg sich stellenweise der Turm der Blomenburg zeigt.
Die Bahn tritt in die im Jahre 1900 aus Teilen des Gutsbezirks Wittenberg neugebildete Gemeinde Martensrade, links Ortschaft Stellböken, dahinter links auf der Höhe das kaum sichtbare Gut Wittenberg, dann hinter Ellhornsberg links das zum Gut gehörige Gehege Rögen. Die Bahn führt nun ca. 5 km durch das Gut Rastorf, von Rastorfer Passau aus im Tal der Passau, links Meierhof Wildenhorst, rechts Blick auf die Höhen am Meierhof Hoheneichen (Lilienthaler Berg) mit bedeutenden Aufforstungen. In langem Einschnitt in starker Kurve zum Bahnhof Rastorf, beim Über- gang über die Spolsau rechts Blick auf das Herrenhaus Rastorf und das in den Bäumen versteckte Herrenhaus Bredeneek. Rechts Hof Bredeneek, dann durch ein kleines Gehege zum Bahnhof Rethwisch, links das kleine Dorf Dammdorf und darüber die großen Wirtschaftsgebäude des Hofes Rethwisch. Vorbei an der Ziegelei Wakendorf auf die Höhen vor Preetz, rechts hübscher Blick in das Schwentinetal auf das adlige Kloster Preetz und Klosterhölzungen, dann in starkem Gefälle unter Überschreitung der Wakendorfer Straße, der Schwentine, der Mühlenstraße in den Kleinbahnhof Preetz, wo die Fahrt endet. Die Verbindung zwischen dem Kleinbahnhof und dem Staatsbahnhof Preetz wird durch eine jenseits des Eisenbahntunnels abgehende Kurve hergestellt.“
Strecke der Kleinbahn auf Google Maps

Schöne landschaftliche Ausblicke während der Fahrt waren jedoch kein Bestandteil bei der Planung der Streckenführung. Die einflussreichen Gutsbesitzer setzten eine ihnen genehme Linienführung durch, um ihre landwirtschaftlichen Produkte zu transportieren. Als damaliger größter Grundbesitzer mit einer großen Mühle, sowie einer Malzfabrik und einer Bierbrauerei machte allen voran die Klosterverwaltung in Preetz ihren Einfluss geltend. Forderungen nach einer Anbindung an Selent oder die wirtschaftliche Ausrichtung Lütjenburgs auf Kiel und Plön wurden nicht berücksichtigt.
Hauptbeförderungsgüter waren Milch für die Milchzentrale in Lütjenburg sowie Getreide, Rüben, Futter- und Düngemittel, Holz, Wege- und Brennstoffe, Baumaterial und Stückgut. Die Kleinbahn bediente die Güter Rethwisch, Rastorf, Wildenhorst, Wittenberg, Lammershagen, Friedeburg, Rantzau, Neuhaus, Klamp und Helmstorf, aber auch Ziegeleien und eine Kiesgrube.
Mit dem Ausbau der Reichsstraße Lütjenburg-Raisdorf (B 202) und der Eröffnung der Autobuslinie Lütjenburg-Kiel ging die Beförderung der Kleinbahn schlagartig um 30 Prozent zurück. Proteste wurden laut, Versammlungen wurden abgehalten und ein Versprechen der Großgrundbesitz ihre Bahn in Zukunft mehr zu benutzen wurde nicht eingehalten. Bürgermeister Günther aus Lütjenburg bemerkte kritisch: „Wir sehen draußen vor dem Gasthof in dem wir tagen einen großen Autopark. Wenn das Interesse für den Personenverkehr an der Bahn so groß ist, hätte auch die Kleinbahn für die Personenbeförderung benutzt werden müssen.“
Eine Pressenotiz aus dem Jahr 1930 bringt es auf dem Punkt: „Die Erbauung der KLB mit der jetzigen Linienführung barg schon ihren evtl. Untergang in sich.“
Erneute Darlehen, eine Fahrpreiserhöhung und die Verpfändung - später sogar der Verkauf - einer Lok hielten die KPL noch ein paar Jahre am Leben, konnten aber das nahende Ende nicht verhindern. Die Liquidation der Grundstücke, Gebäude und der zum Bahnbetrieb notwendigen Geräte und Anlagen dauerte noch bis ins Jahr 1951. Die spätere Schlußbilanz wies einen Reingewinn von 393,02 DM aus.
· 1897 – Erste Überlegung im Kreisausschuss Plön zum Bau einer Bahnstrecke Preetz-Lütjenburg
· 29.03.1898 – Kreistag stellt 2000 DM für die Vorarbeiten zur Verfügung
· 2.12.1902 – Kreistag genehmigt Mittel für den Bau der Kleinbahn
· 1906 – Planung fertiggestellt, geplante Bauzeit 2 Jahre
· 21.07.1908 – Gründung der „Kleinbahn-Aktien-Gesellschaft Kirchbarkau-Preetz-Lütjenburg“ (KPL)
· 1.10.1910 – Eröffnung Streckenabschnitt Preetz-Lütjenburg
· 2.04.1911 – Eröffnung Streckenabschnitt Kirchbarkau-Preetz
· 1919 – Entfernung Anschlussgleis Ziegelei Wakendorf
· 1927 – Bau Anschlussgleis Ziegelei Gottesgabe
· 1930 – Ausbau Reichsstraße Lütjenburg-Kiel, Eröffnung Autobuslinie
· 1.04.1938 – Einstellung Personenverkehr Kirchbarkau-Preetz
· 13.04.1938 – Auflösung der KPL
· 15.05.1938 – Betrieb Kirchbarkau-Preetz eingestellt, Abbruch der Bahnanlagen
· Juni 1939 – Verkauf des Streckenabschnitts Lütjenburg-Neuhaus an das Deutsche Reich
· bis 1943 – Bahnverkehr zwischen Lütjenburg und Fliegerhorst Bellin
Die Kleinbahn hatte eine Spurbreite von 1435 mm (Normalspur) und fuhr auf 41,516 km Streckenlänge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (ab 9.03.1926 mit 40 km/h).
Noch heute lassen sich große Teile der ehemaligen Trasse bei Wanderungen erleben. Auf der 41 km langen Strecke gab es nicht weniger als 23 Haltestellen. Die meisten Haltestellen hatten massive Bahnhofsgebäude sowie Ladegleise. Der Bahnhof Lammershagen war außer den drei großen Namensbahnhöfen der größte Zwischenbahnhof mit zwei Ausweichen und einer Wasserstation. In Lütjenburg mündete die Kleinbahn in den Staatsbahnhof ein. Hier befand sich ein kleiner Lokschuppen mit Wasserstation und Kohleladestelle. Neben dem Bahnhofsbau stand das landgräfliche Empfangsgebäude, ein kleiner hölzerner Prachtbau. In Großbarkau steht der einzige Bahnhof in Holzbauweise kurz vor dem Verfall. Der Alte Bahnhof in Kirchbarkau ist heute ein Mehrfamilienhaus, aber immer noch als Bahnhof erkennbar. Der imposante Damm über die Lammershagener Teiche dient heute als Wirtschaftsweg. Die Brücke über den Postsee ist heute ein beliebter Fuß- und Radweg. Ebenso die markante Unterfahrung des hohen Staatsbahndammes in Preetz.
Vereine und Gilde
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
Klamp in Zahlen
Die Gemeinde Klamp liegt im Ostholsteinischen Hügelland, im nordöstlichen Teil des Kreises Plön, westlich des Selenter Sees und südwestlich der Stadt Lütjenburg. Die Entfernung zur Landeshauptstadt Kiel beträgt Luftlinie ca. 25 Km. Im Südosten bildet die Kossau auf einer Länge von ca. 3.5 Km die Grenze zur Nachbargemeinde Helmstorf. Die übrigen Nachbargemeinden sind Lütjenburg im Nordosten und Giekau im Nordwesten und Westen. Auch zu diesen Gemeinden werden die Grenzen größtenteils durch Fließgewässer markiert. Als natürliche Grenze zu diesen Gemeinden ist außerdem der Rand einer Stauchendmoräne im Gelände sehr deutlich zu erkennen. Als wesentliche Straßenverbindungen verlaufen im Norden die B 202, teilweise durch das Gemeindegebiet, teilweise nördlich davon, und im Südosten auf Gemeindegebiet, entlang der Kossau, die B 430. Eine Gemeindestraße verbindet die Ortschaften Klamp, Rönfeldholz, Wentorf und Vogelsdorf. Rönfeldholz und Wentorf bilden Siedlungskerne in der Mitte des Gemeindegebietes, Vogelsdorf liegt am Stadtrand von Lütjenburg. Das ehemalige Gut Klamp mit einem kulturgeschichtlich bedeutsamen Gutshaus liegt im Norden. Weitere Kleinsiedlungen bzw. Einzelgehöfte sind Winterfeld, Ellert, Charlottental und Rodenkrog. Gemeindegrenzen: Google Maps
Insgesamt leben auf einer Gemeindefläche von 972 ha 612 Einwohner (Dez. 2023) = 63 Einwohner pro km². 80% der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt, weitere 12,5% sind in forstwirtschaftlicher Nutzung. Laut Erhebung des Statistischen Landesamtes von 1993 entfallen auf die Nutzungsarten
Gebäude- u. Freiflächen: 28 ha
Betriebsfläche: 5 ha
(dar. Abbauland: 4 ha)
Erholungsfläche: 1 ha
Verkehrsfläche: 30 ha
Landwirtschaftsfläche: 782 ha
Wald: 121 ha
Wasserfläche: 4 ha
Flächen anderer Nutzung: 2 ha
Ein breiter Landschaftsstreifen südwestlich Lütjenburgs, entlang des Kossautals und die Siedlungsbereiche Vogelsdorf, Wentorf und Rodenkrog einschließend, ist als kleinräumiges Erholungsgebiet ausgewiesen.
Das seit 1985 bestehende Naturschutzgebiet (NSG) "Kossautal" ist als geplantes Naturschutzgebiet mit dem Schutzzweck "Erhaltung einer typisch ausgeprägten eiszeitlich entstandenen Schmelzwasserrinne und eines naturnahen Bachlaufes mit beispielhaft ausgebildeten Mäandern" aufgeführt. Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Hohwacht (Ostsee), Panker und Umgebung" ist mit einer Fläche von mehr als 6000 ha das größte Landschaftsschutzgebiet im Kreis Plön. Große Teile der Gemeinde Klamp, über 70% der Gemeindefläche, befinden sich in diesem Landschaftsschutzgebiet. Als Wasserschongebiet ist der im Einzugsbereich der Kossau liegende Teil des Gemeindegebietes gekennzeichnet. Die Begrenzung fällt annähernd mit der des LSG zusammen, zusätzlich sind noch die Ortschaften bzw. Ansiedlungen Rönfeldholz, Wentorf, Charlottental und Eetz mit eingeschlossen. Wasserschongebiete haben keinen rechtsverbindlichen Charakter, stellen jedoch einen Hinweis auf besonders zu schützende Gebiete dar.
Ein Gutshaus aus dem 18. Jhd. in der Ortschaft Klamp ist das einzige für das Gemeindegebiet verzeichnete Baudenkmal. Aus landschaftsplanerischer Sicht haben die für weite Teile des Kreises Plön typischen Gutsanlagen und Bauten des Großbauerntums als Hinweis auf die historische Besiedlung und Bewirtschaftung besondere Bedeutung. Ebenso ist für die Gemeinde Klamp nur ein archäologisches Denkmal aufgeführt. Es handelt sich um eine hier nicht näher bezeichnete Grabhügelgruppe in dem Waldstück bei der Ansiedlung Ellert. Der Denkmalschutz erstreckt sich nicht nur auf die Erhaltung des Denkmals selbst, auch die Umgebung ist mit einzubeziehen. Beidseitig der Kossau ist ein 50 m breiter Streifen als Erhohlungsschutzstreifen nach unter Schutz gestellt.
Klamp ist Teilgebiet der "Ostholsteinischen Hügel- und Seenland", daß sich vom Nord-Ostseekanal bis südlich ins Gebiet von Storman und Nordlauenburg hinein erstreckt.
Adressen
Historische Adressbücher
Adreßbuch der Herzogthümer Schleswig, Holstein, Lauenburg 1857
Adreßbuch für die Herzogthümer Schleswig-Holstein und das Fürstenthum Lübeck 1869
Adreßbuch für Schleswig-Holstein, Lauenburg und das Fürstentum Lübeck 1884
Adreßbuch für Schleswig-Holstein, Lauenburg und das Fürstentum Lübeck 1897
Ibbekens Adreßbuch für Schleswig-Holstein 1911
Ibbekens Adreßbuch für Schleswig-Holstein 1922
Landwirtschaftliches Adressbuch 1950
Kreis Plön/Adressbuch 1958
| Adressbuch Schleswig-Holstein - Lütjenburg und Umgebung | |||
|---|---|---|---|
| 1857 | 1869 | 1884 | 1897 |
| Gutsbesitzer: C. Graf von Holstein auf Waterneverstorf Kammerherr und Hofjägermeister M. von Buchwaldt auf Helmstorf H. C. H. Graf von Brockdorff auf Klethkamp Kmh. C. von Buchwaldt auf Neudorf F. Graf von Hahn auf Neuhaus Pächter: Theophile zu Klamp Martens zu Vogelsdorf |
Clamp: C. Theophile, Pächter Panker: Landgraf Friedrich v. Hessen Besitzer von Panker Hohenfelde, Schmoel u. Clamp v. Buchwaldt, Pächter H. C. Göttsche, Justizrath Ober-Inspector, Gutsobrigkeit C. Lübbe, Inspector F. Löck, Oberförster F. Hansen, Meiereipächter Vogelsdorf: F. Martens, Pächter |
Clamp: Lühr, H., Pächter Vogelsdorf: Martens, F., Pächter |
Klamp: Lühr, Herm., Gutspächter Rönfeldholz: Beeck, Asmus, Gastwirth Möller, Heinr., Bauernvogt Vogelsdorf: Makoben, Fritz, Bauernvogt Martens, Friedr., Hofpächter Kortum, L., Müller Wentorf: Braasch, W., Holzvogt Lamp, Chr., Schmiedemstr Lembke, Fr., Lehrer Peters, H., Lehrer Wulf, Jochim, Bauernvogt |
| Ibbekens Adressbuch Lütjenburg | Landwirtschaftl. Adressbuch | |
|---|---|---|
| 1911 | 1922 | 1950 |
| Vogelsdorf: Kay, Karl, Halbhufenpächter Kortum, L., Müller Makoben, Frik, Bauernvogt Martens, Wulf, Hofpächter Wentorf: Jipp, W., Hufenpächter Lamp, Ww., Schmiede Makoben, F., Hufenpächter Makoben, W., Hufenpächter Möller, W., Ww., Hufenpächterin Rönnfeldt H., Hufenpächter Scheel, J., Hufenpächter Schneider, J., Hufenpächter Thiessen, Otto Lehrer Wulf, C., Ww., Hufenpächterin Wulf, W., Hufenpächter zu Rodenkrog Rönfeldholz: Beeck, Asmus, Gastwirt Ehlen, Wilh., Schuhmacher und Höker Ehrk, Pantoffelmacher Haß, Händler. Möller, Heinrich, Bauernvogt. |
Vogelsdorf: Kay, Karl, Halbhufenpächter Kortum, L., Müller Kortum, L., Fa. L. Kortum, Mühlenbetrieb Lübker, Gust., Halbhufenpächter Martens, F., Vorsitzender Landwirtschaftlicher Verein der Herrschaft Hessenstein Martens, Fritz, Hofpächter Wentorf: Jipp, W., Hufenpächter Makoben, F., Hufenpächter Makoben, W., Hufenpächter Möller, Gust.., Hufenpächter Rönnfeldt H., Hufenpächter Saggau, Hugo, Lehrer Scheel, J., Hufenpächter Schneider, J., Hufenpächter Schuhmacher,Friedr., Schmied Voß, Friedr., Hufenpächter Rönfeldholz: Beeck, Asmus, Gastwirt Ehlen, Wilh., Schuhmacher und Höker Ehrk, Pantoffelmacher Haß, Händler Möller, Heinrich, Bauernvogt |
Vogelsdorf Gleßmann, Otto Jahn, Herbert Kay, Karl Kortum, Friedr. Lange, H. W. Lübker, Gustav Makoben, Wilh. Ruser, Otto Wentorf Beck, Ernst Dralle, Wilh., Klamp Ehrk, Karl Makoben, Adolf Möller, Elli Möller, Friedrich Paustian, Hermann Riechers, Julius Rönnfeldt, Gustav Rönnfeldt, Viktor Rönnfeldt, Wilh. Scheel, Berta Scheel, Emma Schneider, Wilh. Schumacher, Friedr. Thomsen, Heinrich Voß, Hermann Wulf, Hans |
| Der Landkreis Plön - Geschichte, Landschaft, Wirtschaft, Einwohner | |||
|---|---|---|---|
| 1958 - Vogelsdorf | 1958 - Wentorf | 1958 - Rönfeldholz | 1958 - Klamp |
| Barra, Alex, Postfacharbeiter Bock, Gustav, Arbeiter Böttcher, Wilhelm, Rentner Dohrmann, Werner, Bohrer Gleßmann, Otto, Landwirt Hagedorn, Ernst, Maurer Hagedorn, Friedrich, Arbeiter Hagedorn, Helmut, Maschinenschlosser Hass, Klara, - Höppner, August, Elektriker Jipp, Friedrich, Maurer Kaminski, Karl, Landarbeiter Kay, Marie, Landwirtin Kortum, Friedrich, Müller Krumbeck, Ludwig, Landarbeiter Kruse, Gisela, - Kruse, Helmut, Händler Kruse, Otto, Tischler Lange, Elise Lange, Hans-Ulrich, Jungbauer Lange, Hans-Wilhelm, Landwirt Liedtke, Grete Löll, Bruno, Arbeiter Lübcker, Ernst + Frieda, Landwirt Makoben, Hans, Jungbauer Makoben, Wilhelm, Landwirt Meyer, Karl, Justizangestellter Oden, Alfred, Maler Paustian, Gustav, Maurer Petersen, Karl, Zimmermann Rath, Hans, Maschinenbaumeister Rosborg, Martha, Pensionärin Ruser, Otto, Landwirt Scheel, Wilhelm, Rentner Schein, Gertrud Schleef, Karoline Schlichting, Otto, Arbeiter Schütt, Heinrich, Schlosserhelfer Steinbacher, Meta Steinbacher, Therese |
Albert, Walter, Arbeiter Appenowitz, Gustav, Arbeiter Appenowitz, Gustav, Arbeiter Arp, Bernhard, Schlosser Arp, Eduard, Rentner Arp, Ernst, Rentner Arp, Hans, Fischer Arp, Hugo, Kaufmann Arp, Johannes, Rentner Arp, Rolf, Schlosser Arp, Willi, Arbeiter Bandowski, Dieter, Dreher Bandowski, Franz, Rentner Bandowski, Fritz, Melker Bandowski, Heinz, Melker Bengisch, Martha Brassat, Johanna, Rentnerin Bremer, Hilda, kfm. Angestellte Bremer, Karl, Maurer Buchweitz, Arno, Arbeiter Buchweitz, Horst, Stellmacher Diekmann, Emil, Landarbeiter Diekmann, Ernst, Landarbeiter Diekmann, Heinz, Schäfer Diekmann, Reinhard, Landarbeiter Dingelstein, Gottlieb, Schlosser Dunker, Karl, Fischer Dunker, Olga, Rentnerin Durdel, Karl, Landarbeiter Durdel, Siegfried, Landarbeiter Däring, Helene Däring, Henny, Rentnerin Däring, Monika, kfm. Angestellte Ehrhardt, Alfred, Arbeiter Evers, Ernst, Zimmerer Evers, Hugo, Landarbeiter Frahm, Heinrich, Elektriker Frahm, Hertha, Rentnerin Goldschmidt, Ursula Groth, Hans-Adolf, Arbeiter Gröpper, Elise, Rentnerin Göttsch, Ernst, Maurer Göttsch, Ewald, Maurer Göttsch, Heinrich, Fischer Göttsch, Hermann, Fischer Göttsch, Werner, Fischer Hagedorn, Bernhard, Fischer Hagedorn, Günther, Fischer Hagedorn, Hans, Fischer Hagedorn, Wilhelm, Schuhmacher Hamann, Erich, Bootsmann Hamann, Heinrich, Bootsmann Hamann, Hermann, Landarbeiter Heller, Alfred, Bauer Heybeck, Helmut, Dreher Heybeck, Klaus, Arbeiter Hilbert, Erwin, Arbeiter Hilbert, Karl-Heinz, Landarbeiter Hilbert, Walter, Arbeiter Horst, Edgar, Arbeiter Horstmann, Helene, Rentnerin Huhn, Franz, Friseur Höft, Emil, Rentner Kahl, Erich, Arbeiter Kahl, Hermann, Arbeiter Kenklies, Manfred, Maler Klatte, Hermann, Maler Klindt, Heinrich, Landwirt Klindt, Herbert, Bauer Klinkem, Heinz, Lehrer Kroll, Anni Kroll, Karl, Rentner Kroll, Ludwig, Arbeiter Kruse, Gerhard, Arbeiter Krützfeldt, Claudius, Gastwirt Krützfeldt, Liselotte, Rentnerin Kähler, Hugo, Landarbeiter Lamp, Johannes, Tischler Lehmann, Hertha, Rentnerin Lehmann, Horst, kfm. Angestellter Lüth, Rudolf, Melker Lüth, Werner, Arbeiter Marquardt, Gerhard, Landwirt Marsell, Karl, Rentner Mewes, Charles, Melkermeister Müller, Walter, Landarbeiter Petereit, Georg, Rentner Pohl, Herbert, Landarbeiter Prahl, Hilde, Arbeiterin Reimann, Gerda Reusch, Franz, Arbeiter Röhlk, Erich, Arbeiter Röhlk, Hermann, Landwirt Röhlk, Kurt, Landwirt Schachlys, Minna, Rentnerin Schneekloth, Erna Schneekloth, Heinrich, Fischer Schneekloth, Karl-Heinz, Schlosser Schneekloth, Walter, Fischer Schulz, Hildegard Schwarten, Albert, Arbeiter Schwarten, Anne, Rentnerin Schwarten, Heinz, Fischer Schwarten, Hertha, Rentnerin Schwarten, Kurt, Schiffszimmermann Schwarten, Peter, Fischer Schütt, Anni, Rentnerin Steffen, Bernhard, Schiffbauer Steffen, Cäcilie, Rentnerin Steffen, Otto, Zimmerer Steffen, Willi, Fleischbeschauer Stoltenberg, Hermann, Altenteiler Tautz, Emma, Rentnerin Thiersee, Richard, Arbeiter Untiedt, Anni, Altenteilerin Untiedt, Helene, Altenteilerin Untiedt, Magdalene, Laborantin Vandreier, Paul, Arbeiter Wiese, Bernhard, Altenteiler Wiese, Erna Wiese, Hans-, Joachim, Bauer Wiese, Herbert, Bauer Wiese, Hermann, Landwirt Witt, Erich, Bauunternehmer Witt, Horst, Arbeiter Wittstock, Albert, Rentner Wunder, Otto, Arbeiter |
Bartsch, Elisabeth Beck, Auguste Beck, Hans, Gastwirt Bock, Olga Boll, Heinrich, Arbeiter Boll, Karl, Landarbeiter Burat, Otto, Bohrer Burat, Willi, Arbeiter Deckers, Luise Dohrmann, Johannes, Waldarbeiter Driller, Wilhelm, Forstarbeiter Ehlers, Ernst, Rentner Ehlers, Fritz, Landarbeiter Ehrk, Heinrich, Rentner Ehrk, Marie Ehrk, Sophie, Hebamme Fischer, Otto, Landarbeiter Franzke, Erich, Bb.Helfer Giese, Ernst, Rentner Giese, Heinrich, Landwirt Hagedorn, Karl, Maurer Hass, Anna Hass, Emil, Maurer Hass, Karl, Arbeiter Hellmann, Anna Henningsen, Hans, Landwirt Hübner, August, Arbeiter Hübner, Friedrich, Schmied Jebe, Heinrich, Stellmacher Jipp, Hermann, Rentner Kahl, Amanda Kurrat, Fritz, Landarbeiter Lorenzen, Otto, Maurer Mienack, Ehrenfried, Vorarbeiter Möller, Friedrich, Landwirt Möller, Otto, Schneider Ortmann, Max, Arbeiter Peterson, Karl, Rentner Redant, Ernst, Steinschläger Rudolf, Herbert, Bauhilfsarbeiter Rönfeld, Viktor, Landwirt Rönfeldt, Frieda Rönfeldt, Johann, Arbeiter Rönnfeldt, August, Bauaufseher Rönnfeldt, Bernhard, Maurer Rüting, Egon, Maurer Schuldt, August, Kutscher Schuldt, August, Autoschlosser Schuldt, Wilhelm, Waldarbeiter Schumann, Hans-Jürgen, Arbeiter Schönfeldt, Erich, Zimmermann Steenbeck, Siegfried |
Barra, Elisabeth, Pensionärin Busch, Karl-August, Landwirt Deckert, Emma Ehrk, Wilhelm, Landarbeiter Hass, Erwin, Maurer Rüder, Kurt, Landarbeiter Thode, Werner, Landarbeiter Trinks, Kurt, Rentner Widderich, Heinrich, Melkermeister Widderich, Heinrich, Rentner |
Schleswig Holstein — Sagen, Anekdoten, Brauchtum
Zwischen Lütjenburg und Plön 1875 - Was die Chaussee erzählt (1955)
Und ewig läuten die Hochzeitsglocken - Der „Grundlose See“ in den Streezer Bergen
Der Sehlendorfer Lutschdorsch
Der Lütjenburger Scharfrichter
Steäf und Skild
Anekdote vom alten Fürsten von Hessenstein
Alter Glaube in Ostholstein
Die „witten Wiewer“ im Voßberge
Der Bierholer
Das Wochenbett im Voßberge
Das Flensburger Feuerschiff
De Bottermelkskrieg to Lüttenborg
Ekke Nekkepenn - eine Meerjungfrau und ein Meermann
Lütjenburger Originale – Der Adolfsnieder
Die Schwarze Grete
Jugend- und Volksspiele - Der Läuferball
Die Braut bittet um Federn zum Brautbett
Die Wochentage in ihrer Beziehung zum Volksglauben
Der Schinder von Dingwatt
Sitten und Bräuche aus vergangenen Tagen
1875 - Was die Chaussee erzählt - Omnibus
Während der gelbe Postwagen mehr den Beamtenstaat, den Stand des reichen Kaufmanns verkörperte, habe ich immer Wilhelm Bolls Omnibus als das Verkehrsmittel des kleinstädtischen Geschäftsmannes kennengelernt. Sein Vorhandensein war eine Notwendigkeit; denn Lütjenburg hatte vor 1890 keinen Eisenbahnanschluß, und immerhin waren es über 20 km, die dieses Verkehrsmittel zu überbrücken hatte. Zweckentsprechend war er auch eingerichtet. Ein geräumiges mit Fenstern versehenes Passagierabteil, ein dreiteiliger mit Lederchaise überdachter Fahrersitz, dahinter auf dem Wagendach ein breiter Freiluftstuhl für die Sommerzeit oder diejenigen, die meine hübsche Umgebung genießen wollten.
Es gab allerdings damals schon Leute, denen daran viel mehr gelegen war, schnell von einer in die andere Stadt zu kommen, als Auge und Herz in diesem meinem Paradiese zu erfrischen. Gerade, wie heute; denn ein großer Teil derjenigen reichen Autobesitzer, die heute pausenlos über mich hinwegbrausen, besitzt nicht das Bedürfnis, langsam zu fahren, anzuhalten, die Augen zu füllen mit dem goldenen überfluß der Landschaft, der bei mir verschwendet wird. Die Jahreszeit ist gleichgültig. Gern gönne ich dem Geschäftsmann den Zeitgewinn, den ich ihm biete. Wenn ich aber an die denke, welche nur ihre Freude am Fahrtempo haben, dann bin ich so traurig und frage mich, warum nehmen diese Städter nicht die volle Schönheit unserer ostholsteinischen Landschaft mit in ihre Steinkästen und sonnen sich noch acht Tage daran.
Das verstanden die Sommerfrischler, die oben auf dem Omnibus saßen, ihre weißen Sommerhüte schwenkten, sangen und nach Kastanien griffen. Auf der Hinterachse war vorsorglich das Reisegepäck festgeschnallt. Die drei Pferde "Dree in de Druuv" hatten es nicht immer leicht. Ihr Herr sorgte für sie, und klatschend fuhr die lange Peitsche in Richtung Gepäckhalter, rückwärts über den Wagenkasten, wenn ein „Zeitgenosse" sich in der Dunkelheit als blinder Passagier auf dem Gepäckhalter eingenistet hatte.
Doch daß Max Lüer aus Rantzau an einem dunklen Herbstabend sein Gefährt benutzte, das hatte Boll nicht bemerkt. Lüer hatte im Rönfeldsholzer Krug reichlich Lütjenburger Kümmel getankt, war hinausgeworfen, schalt den ganzen Weg hinab bis zur Chaussee über die Schlechtigkeit der Menschen, fürchtete wohl bissige Worte seiner Ehehälfte wegen später Heimkehr, hatte auch Angst vor Räubern und begegnete, ohne ihn zu kennen, unserem allerdings von Rantzau kommenden Omnibus. Wie schnell kann doch ein Mensch denken und handeln. Schon hat Lüer den Gepäckhalter des Wagens ergriffen, um jetzt laufend sein Rantzauer Heim zu erreichen. Er war ein stiller Mann, als er sich bald statt auf Rantzau, auf dem Lütjenburger Marktplatz wiederfand.
1875 - Was die Chaussee erzählt - Reiter
Solange ich da bin, hat man mich gepflegt. Ja, in den ersten Jahren noch mehr als heute. Kennt ihr wohl noch die stille Reihe der Chausseeböcke, auf denen die Dorfjungens gern Reiterkunst zeigten? Könnt ihr euch das dumme Gesicht des aufwachenden Fuhrmanns vorstellen, der beim überfahren eines der Böcke sich auf die Zunge gebissen hatte und nun wütend auf die treuen aber unschuldigen Pferde einschlug? Seht ihr noch meine fleißigen Wärter nach der Schnur die Graskante abstechen, um dann den oft sogar geharkten Reitweg herzustellen?
Deren häufigster Gast war wohl der berittene Gendarm. Erstens schonte er seine Rosinante, und zweitens war er leise und plötzlich da, wo etwas nicht in Ordnung war. Vielleicht fuhr ein Wagen in der Dunkelheit ohne Licht, vielleicht liefen ihm zwei „Monarchen" in die Quere. Wißt ihr es noch, wie die armen Tagelöhner vor ihm ins Haus flüchteten, wenn sie am Sonntag oder in der österlichen Zeit, auch am Gründonnerstag, ihren Garten umgruben? Wirtshausbesuch war an Fest- und Feiertagen erlaubt; aber die Gartenarbeit und das Zerkleinern von Brennholz war verboten und wurde bestraft. Die Möglichkeit des plötzlichen und lautlosen Erscheinens des Mannes mit dem blanken Hut" hatten auch die Engelauer Jungens einkalkuliert, wenn sie in der Kossau angelten oder Krebse griffen.
Dennoch! In Ehren sei hier des Gendarmen Rößler gedacht, der den Landstreichern nicht grün war. Aber es entbehrte nicht einer gewissen Komik, wenn er vier Buben in Reih und Glied antreten und alle Taschen umkrempeln ließ, wenn er weder Angeln noch Krebse fand, wenn er in die blassen Gesichter sah, wenn er sie anfuhr und doch nichts aus ihnen herausbekam, obwohl er wußte, daß sie geangelt und gekrebst hatten. Für die Bengels war so ein Verhör die Auslösung von lebenden Hosen. Hoch zu Roß hielt dieser Mann vor ihnen, durchbohrte sie fast mit denselben Augen, mit denen er früher auf dem Kasernenhof seine Artilleristen zu schrecken versucht hatte. Den Helm auf dem Kopf, gewienerte Schuppenketten unter dem Kinn, Goldtressen um ärmelaufchläge und Kragen, zwei Sergeantenknöpfe, und an der Seite das blanke Schwert in vernickelter Scheide. Beim Zeus, der Augenblick war heute ernst; denn Rößler hatte den Säbel gezogen. Besondere Anziehungskraft übten meine Apfelbäume auf die nach Lütjenburg zur Schule reitenden und fahrenden Knaben und Mädchen aus. 1892. In Hamburg wütet die Cholera. Aus diesem Grunde war überall der Genuß rohen Obstes verboten; denn in den Augen der Unmündigen war die Cholera eine verschärfte Form von Durchfall. Gehorsam pflückten die Schulfahrer keine äpfel, sondern fuhren statt dessen mit ihrem Wagen schnell unter den Obstbaum, hieben mit der Peitsche in seine Zweige, verzehrten lachend die äpfel, die in den Wagen gepurzelt waren und erkrankten nicht an Cholera; sie leben heute noch. Auch der beiden Reiterbuben sei gedacht, die auf ihren Schulpferden in den Wiesen am Wachschaar während der Hirschbrunft Damwild durch die Kossau jagten. Beiden ist das Haar ergraut und die Jagdpassion geblieben.
1875 - Was die Chaussee erzählt - Veloziped
Unter all den Fahrzeugen mannigfachster Art, die wir im Laufe der Jahre benutzten, hat keines ein solches Aufsehen erregt wie das Veloziped, das Fahrrad, das um 1885 als neues Verkehrsmittel erschien. Vorn ein gummibereiftes, mit blitzenden Stahlspeichen versehenes, 1,5 m Durchmesser haltendes Rad und dahinter eins von nur 0,40 m. Auf der gebogenen Verbindungsstange der Fahrersitz und davor die vernickelte Lenkstange mit Glocke und Petroleumlampe. Der Antrieb erfolgte auf zwei Pedalen, deren Achse durch die Nabe des großen Rades ging. Es gehörte wirklich Gewandtheit dazu, um in den hohen Sattel zu kommen, um überhaupt fahren zu können. Doch manchem Fahrschüler wurde dies Hochrad zum Verhängnis. Ihr wißt doch alle, daß ich von Dornenhecken eingefriedigt bin. Da ist es passiert, daß nach einem Sturz Sicherheitsnadeln, Heftpflaster und die Pinzette aus dem Verbandskasten heraus mußten; letztere, um dem gestürzten Verkehrsteilnehmer aus seiner Rückenverlängerung ein Dutzend Dornen zu extrahieren. Das Unmögliche war jetzt möglich geworden: Ein Mensch vermochte auf zwei hintereinanderliegenden Rädern die Balance zu halten, zu fahren und froh viele Kilometer zurückzulegen. Welcher Aufwand an Körperkraft aber erforderlich war und welches Quantum an Schweiß geopfert werden mußte, das sagten die Radler nicht nach. Alle diejenigen jedoch, die sich kein Viloziped kaufen konnten, die nicht fahren konnten, standen staunend am Wege, ausgenommen die Hunde, die als erbitterte Feinde des Fortschritts diesem oder jenem in die Strampelbeine fuhren. Schon das äußere Bild von Rad und Fahrer war besonders in der ersten Zeit ihres Auftauchens so ungewohnt und verwirrend, daß eine Frau in ihr Haus hineinrief: „Peter, kumm rasch mal rut, dor föhrt eener ubn Wagenrad!" Natürlich waren meine ersten Radfahrer aus Kiel. Sie brachten bald darauf wieder eine Neuerung. Das Zweirad in seiner heutigen Form war da, nach unserm oberflächlichen Ermessen damals dem Hochrad gegenüber nicht ebenbürtig, in Wirklichkeit jedoch weit überlegen und obendrein bequemer und ungefährlicher. Eines von ihnen hatte den alten Engelauer Nachtwächter Friedrich Wichelmann in Angst und Schrecken versetzt. Er hatte nachts auf der großen Kreuzung gestanden, als ein Licht unter Geklingel an ihm vorbeisauste. Am andern Tage erzählte er im Dorf, ihm wäre heute nacht der Teufel begegnet.
1875 - Was die Chaussee erzählt - Marktwagen
Es will Frühling werden. Die gelben Blüten des Huflattich bedecken schon zu Hunderten als erste Siedler meine hohen Böschungen. Der Eutiner Kalender verzeichnet für den 19. März den Lütjenburger Frühjahrsmarkt. Bald werden von Plön nach Lütjenburg bunte Wagen fahren, kleinräderige, rotgestrichene Unterwagen und darüber das grüne Wohnhäuschen, Küche und Schlafstube zugleich. Saubere Gardinen schmücken die kleinen Fenster. Als Brücke zwischen Himmel und Erde ruht eine Kurztreppe auf dem Fahrgestell. Aus einem kurzen Schornstein kräuselt blauer Rauch und zeigt an, daß es im Ofen knistert, oder daß das Mahl hergerichtet wird. Vor dem Fenster über der Deichsel sitzt der Marktreisende und lenkt ein pflastermüdes Rößlein. Wirklich ein beneidenswerter Platz bei schlechtem Wetter. Das Ganze ist überhaupt so voller Romantik, so voller Rätsel, reizt zu so vielen überlegungen, bringt in einem solchen Maße die Phantasie auf Touren, daß den Engelauer Dorfbuben der Mund aufstehen bleibt. Sie spüren draußen geradezu die mollige Temperatur, die drinnen herrscht, wünschen sich eine Mitfahrt, um nebenbei nach jenen Kästen zu suchen, deren Inhalt sie übermorgen für einen Groschen kaufen können. Bei der Papiermühle erscheint noch ein Gefährt, doch es interessiert nicht; seine Seitenwände zeigen Stiefel. „In Preetz is'n Kloster, und in jeden tweet Hus wohnt 'n Schoster." Was die Frachtfirma Grimm - Plön jetzt heranrollt, ist das Karussell. Es folgt Lüthgens Raritäten-Kabinett und der Transport eines Zirkus. Sonderbare Menschen.
1875 - Was die Chaussee erzählt - Post
Unter allen meinen Fahrzeugen sind noch heute die der Post besondere Wagen. Einesteils ist es ihr äußeres, andererseits ist es das Ansehen ihrer Beamten, die am Steuer sitzen. Als wir 1866 preußisch wurden, und als 1871 die Deutsche Reichspost kam, da rollten in eigener Regie zweimal täglich die gelben Wagen von Lütjenburg nach Plön und zurück. Ihr hinterer, niedriger und verschlossener Teil barg Postsendungen und Geld, war also das Heiligtum. Der mittlere coupetige Wagenteil enthielt einige gute Sitzplätze für wohlhabende Passagiere. Auf stark überhöhtem Fahrersitz thront der Postillion, ein junger Mann in Postuniform. Sein Haupt krönt der traditionelle Helm, und vor seiner Brust hängt das blinkende Horn, das anziehendste Stück am ganzen Gefährt.
Es klirren die Kettenstränge, es rollen dumpf die Räder, und in die Wälder hinein schmettern die Töne und wecken ein liebliches Echo, klingen zu dem Ackersmann aufs Feld, zur Schnitterin, der Schweißperlen über das braune Antlitz rinnen, und wecken überall Entspannung und neue Kraft, wenn auch nur für den Augenblick. Und wenn ein geschickter Bläser nur jene Melodie beginnt, dann singt die Jugend wieder übermütig mit:
„O, du lieber Augustin, alles ist hin! Rock ist weg, Stock ist weg,
Geld ist weg, Mädel ist weg; O, du lieber Augustin, alles ist hin!" Der Postillion war eine angesehene Persönlichkeit, und mancher schnelle Blick blanker Mädchenaugen flog hinauf zu ihm auf seinen hohen Thron. Ich weiß es, die Töne des Posthorns drangen allen tief und nachhaltig ins Gemüt. 1924 schrieb eine alte Bäuerin aus Engelau an ihren Sohn: „Denke nur, die Post fährt wieder von Lütjenburg nach Plön, und wie einst klingen Signale durch die Wälder (Hupe).

Und ewig läuten die Hochzeitsglocken — Der „Grundlose See“ in den Streezer Bergen — Ein dunkles geheimnisvolles Auge
Mitte des 17. Jahrhunderts, stand an der Ostseite des Sees eine Wassermühle, welche von den Bewohnern der umliegenden Dörfer fleißig besucht wurde. Der Müller war ein einfacher, schlichter Mann und fühlte sich in seinem idyllischen Heim so wohl, dass er mit keinem Fürsten der Welt tauschen mochte.
Sein größter Reichtum und Stolz aber war sein einziges Töchterlein Anna, eine schlanke schmucke Jungfrau. Lust und Lebensfreude strahlten aus Ihrem rotwangigen, zarten Gesichtchen und für jeden hatte sie immer einen freundlichen Gruß und ein fröhliches Wort auf den Lippen. Wie ein gutes Wort immer einen guten Ort findet, so wusste sie auch stets die Herzen aller für sich einzunehmen. Darum fehlte es ihr auch nicht an Bewerbern, welche um ihre Hand anhielten. Sie aber dachte nicht daran, das Haus ihrer Eltern zu verlassen, um einem Anderen zu folgen. Ihr waren die mit Busch bewachsenen Hügel am See und der rauschende Wald ans Herz gewachsen und sich von ihnen zu trennen, fiel ihr schwer. Auf einem weit in den See hinaus hängenden, niedrigen Buchenast saß sie oft stundenlang im Genusse der schönen Natur versunken. Hier war ihr Lieblingsaufenthalt.
Während nun hier ein heiliger Friede wohnte, wütete im deutschen Reiche der 3o-jähriger Krieg. Aber auch dieser Ort sollte nicht von ihm verschont bleiben. 4000 Mann des kaiserlichen Heeres waren in Holstein eingebrochen und schlugen bei der Stadt Lütjenburg ihr Lager auf. Schlimme Zeiten brachen über die Bewohner dieser Gegend herein, denn Plünderung, Raub, Mord und Brandstiftung waren die steten Begleiter dieser Horden. Auch die einsame Mühle im Walde wurde von ihnen aufgesucht.
Es war eines Mittags, als sich die Familie beim Essen befand, da erschien ein Trupp Reiter, welcher vom Müller nicht nur die Herausgabe von Korn und Mehl, sondern auch sämtliche Wertgegenstände verlangten. „Tust Du nicht willig“, schrien einige ihm zu, „so setzen wir Dir den roten Hahn aufs Dach“. Andere packten ihn am Halse und würgten ihn. Als das die Tochter sah, warf sie sich verzweifelt zwischen die Krieger und ihren Vater. „Habt Erbarmen mit uns“, rief sie, „wir geben Euch gerne was ihr an Lebensmittel begehrt, so gut wir können, aber schont unser Haus, schont das Leben meines Vaters!“. Erst waren die rohen Gesellen über den Auftritt des Jungen Mädchens etwas verdutzt, aber bald gewannen die Rohheit und der übermut wieder die Oberhand über sie. Hohnlachend stießen sie das Mädchen zurück und warfen sie zur Haustür hinaus, so daß sie hinfiel. „Kümmert euch nur um eure Suppe, Jungfrau und steckt eure Nase nicht zwischen Kriegsleute“, riefen sie und drangen von neuem auf den Müller ein. Da trat ein junger Korporal ins Haus. Er hatte gesehen, wie das arme Kind hingefallen war. Sie aufhebend gebot er den Kriegsknechten von dem Alten abzulassen und sich heraus zu begeben. Befreit atmete die Familie des Müllers auf, als die rohen Gesellen das Haus verlassen hatten, „Oh wie danken wir euch, sprach das Mädchen zu dem jungen Korporal, „dass ihr uns vor großem Unglück bewahrt habt“. „Darf ich euch einladen, an unserem Tische mit zu essen“ fragte der Müller. Der Korporal nahm das Anerbieten dankbar an. Beim Essen erzählte er seine Lebensgeschichte, dass er als Sohn eines polnischen Grafen seine Eltern verlassen habe, um in den Reihen des kaiserlichen Heeres sein Glück zu finden und ihn nun das Schicksal hierher verschlagen habe. Ich habe manches Abenteuer erlebt, manchen harten Kampf ausgefochten, aber das Glück, welches ich suchte, habe ich nicht gefunden. Das Leben und Treiben im Heere und die Rohheiten der Krieger widern mich an. Ihr werdet vor derartigen Besuchen wie heute, für die Folge nicht sicher sein. Um Euch aber zu schützen, werde ich zwei meiner Leute bei euch einquartieren. Die sollen euch bewachen und beschützen. Ich komme bald wieder und nun Iebt wohl bis morgen.
Bald hörte die Müllersfamilie am Getrappel der Rosse, dass sich der Trupp entfernt hatte, nur zwei hielten noch draußen Wache vor dem Hause des Müllers. Anderen Tages erschien der Korporal wieder und es entwickelte sich zwischen ihm und der Müllersfamilie ein freundschaftliches Verhältnis. Besonders war er dem jungen Mädchen gut gesonnen und ihretwegen kam er täglich nach der Waldmühle, wo er die langen Winterabende gern im Kreise der Freunde verbrachte.
Als der Frühling ins Land zog, die Bäume und Sträucher des Waldes sich mit dem ersten saftigen Grün schmückten und die Wiesen sich mit bunten Blumen bekränzten, da litt es auch den Menschen nicht mehr in ihren engen winterlichen Hütten. Auch die Müllerstochter war hinausgegangen zu ihrer geliebten Buche, um im hellen Sonnenschein die Luft des Frühlings zu genießen. Da erschien unser Korporal und setzte sich neben sie auf den Ast der Buche. Lange schwiegen sie beide und blickten auf das Wasser hinab welches langsam zu ihren Füßen dahin floss. Endlich sprach er ihre Hand ergreifend. „Ich habe das Kriegsleben satt, würdest Du mich nach meiner Heimat begleiten und meine Frau werden?“ Sie willigte ein und man verständigte die Eltern davon. Es wurde beschlossen, dass die Hochzeit am 1. Pfingsttage gefeiert werden sollte.
Die Kunde von der Verlobung des Grafen und der Müllerstochter war bald bei seinen Kameraden bekannt geworden. Einige beglückwünschten ihn von Herzen. Bei anderen waren aber der Neid und die Abgunst. Ihr Sinnen und Denken richtete sich darauf, ihm einen Streich zu spielen und seine Vermählung zu hintertreiben.
Als der Korporal am Abend vor dem festgelegten Hochzeitstage aus der Waldmühle ins Lager zurückkehrte, übergab ihm einer seiner Kameraden einen Befehl zum sofortigen Aufbruch nach einem entfernten Orte, von wo aus er erst in acht Tagen wieder zurück sein konnte. Als gehorsamer Soldat machte er sich sofort an die Ausführung des Befehls, gab jedoch einem seiner Kameraden den Auftrag, seiner Braut und deren Eltern von dem plötzlich eingetretenen Hindernis Kenntnis zu geben. Getreulich gingen anderen Tages seine Kameraden hinüber zur Waldmühle, jedoch nicht um ihren Auftrag auszurichten, sondern sich an der Verlegenheit der Müllersfamilie zu weiden.
Als nach langem, geduldigem Warten der Bräutigam immer noch nicht erschien, bemächtigte sich der Braut eine geheime Angst. Am liebsten wäre sie hinaus geeilt, dem Liebsten entgegen, aber in ihrem Hochzeitsschmuck mußte sie bei den Gästen ausharren. Als die Soldaten die Unruhe des Mädchens bemerkten, ergingen sie sich in Sticheleien über die Untreue ihres Kameraden, der ausgerückt sei und sicher nicht wiederkommen werde. Als die Braut dies vernahm, bemächtigte sich ihrer eine große Aufregung. Ihr wurden die Wände des Zimmers zu eng. Sie hätte aufschreien mögen vor Schmerz und Verzweiflung. Sie floh hinaus aus dem Hause, hinaus in den dämmernden Wald zu ihrer geliebten Buche, wo sie oft Trost und Frieden gefunden hatte.
So saß sie lange da, das glühende Gesicht in ihren Händen. Aus Ihren Augen quollen Tränen und benetzten ihren Schleier. Aus dem See stiegen weiße Nebel auf, welche sich auf- und abbewegend auf der glatten Wasseroberfläche lagerten. Der Müllerstochter kam es so vor, als wenn diese Nebelbank lebendig würde, als weiße Nixen auf dem Wasser tanzten und ihr zuriefen und winkten „komm zu uns, hier findest du Frieden“. Plötzlich war es ihr, als ob sich der See öffnete, von weißen Nixen getragen glitt sie langsam hinunter in das Reich der Wassergeister, wo sie Ruhe und Frieden finden sollte.
Nachdem sich die Hochzeitsgäste entfernt hatten, suchte man das Mädchen, fand es aber nirgendwo. Sie war spurlos verschwunden, nur an einem Zweige der Buche fand man ein Stückchen ihres Schleiers. Man fischte den See ab, aber das Mädchen wurde nicht gefunden. Als der Korporal von seiner Reise zurückkehrte, fand er Eltern in tiefer Trauer. Traurig schlich er sich zu der Buche am See. Hier setzte er sich, in tiefes Sinnen versunken, in die Gezweige nieder. über ihm glühte das Abendrot am Himmel und unter ihm spiegelten sich in dem stillen See die langsam dahin ziehenden lichten, rosigen Wolken so klar und durchsichtig wie der Schleier einer Braut. Plötzlich glaubte er hinter einer dieser leichten Wölkchen das Antlitz seiner Braut zu erkennen. Einen Kranz von Seerosen im Haar, schien sie ihm zu winken. Er rief: „Oh Anna, warum hast du mir das angetan, grundlos waren deine Zweifel an meiner Treue, grundlos war deine Tat. Oh decke auch mich dieser See zu, wie dich“. Ein lautes Schluchzen des Wassers ertönte, dann war alles stil. Der Korporal war in der Tiefe verschwunden.
Als seine Kameraden anderen Tages nach ihm suchten, fanden sie nur seinen Helm im Gezweige der Buche. Er selbst aber war verschwunden. Man grub einen tiefen Graben, um den See ablaufen zu lassen, aber die Arbeit war vergebens. Der See erwies sich als grundlos. Die Mühle ist im Laufe der Zeit verschwunden, der Graben aber, welchen die Soldaten damals ausgehoben haben, ist noch vorhanden, der sogenannte Russengraben. Ein herrlicher Buchenwald bedeckt die Stätte der einstigen Mühle. Wer aber am Morgen des ersten Pfingsttages diesen See aufsucht, glaubt oftmals aus der Tiefe desselben, das Läuten der Hochzeitsglocken zu vernehmen. (Text aus dem „Lütjenburger Sagenkranz“)
Der Sehlendorfer Lutschdorsch
Wer kennt ihn nicht, den schönsten Strand an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein. Wo eine ursprüngliche Naturlandschaft sanft ihren feinen, weißen Sand in die See entlässt und die Seele beim Blick in die Weite baumelt. Ja, genau, die Rede ist vom Sehlendorfer Strand an der Hohwachter Bucht.
Aus dem Reisetagebuch eines Touristen (Juli 1994):
Es war Sommer. Ein sehr heißer Sommer. Einer dieser Hochsommertage im August, die man nur mit einem schattigen Plätzchen am Mittag und ausgiebigen, kühlenden Bädern so richtig genießen konnte. Es war mein erster Urlaubstag am Sehlendorfer Strand. Ich lag friedlich auf meinem Strandtuch und dachte an — nichts. Da verfing sich mein Blick an zwei Männern, die auf der letzten Sandbank in der Bucht bis zum Bauchnabel im Wasser standen. Soweit, so gewöhnlich. Wäre da nicht dieses seltsam anmutende Gebaren gewesen, das meine Aufmersamkeit erregte. Völlig regungslos standen so dort, die Hände entspannt im Nacken verschränkt, schweigend, den Blick weit in die Ferne gerichtet.
Die Minuten verrannen. Die zwei Gestalten auf der Sandbank verharrten weiter still in ihrer meditativen Haltung — unbeeindruckt von dem bunten und lauten Treiben am Strand. Dann, ohne erkennbaren Grund, wie auf ein geheimes Komando, lösten sie sich ansatzlos aus ihrer Starre, um entspannt lächelnd an den Strand zu waten. Neugierig geworden, schlenderte ich ihnen durch den heißen Sand entgegen.
„Hallo, äh, Moin“, stammelte ich. „Sagt mal, was habt ihr da gerade im Wasser gemacht?“ Die zwei guckten sich wissend an. Einer von ihnen erwiderte: „Wir haben auf den Lutschdorsch gewartet.“ Ich riss die Augen auf: „Ihr habt WAS?“ - „Auf den Lutschdorsch gewartet“, wiederholte der andere Typ gelassen. Das Fragezeichen in meinem Gesicht muss derart riesig gewesen sein, dass der erste Kerl sich zu einer Eklärung genötigt sah: „Der Sehlendorfer Lutschdorsch ist so eine Art Putzerfisch, der Körper und Seele reinigt. Eine endemische Art. Den gibt es nur hier am Strand von Sehlendorf. Und um den Lutschdorsch anzulocken, muss man diese ganz besondere Körperhaltung einnehmen und vor allem muss man dabei vollkommen ruhig sein.“
„Ah, aha
“, sagte ich und fuhr dann vermeintlich mitwissend grinsend fort: „Und was passiert, wenn der Lutschdorsch dann kommt?“ — „Das wirst du dann schon merken, wenn er da ist.“, kam die promte Antwort und die zwei Kerle machten sich lachend davon.
„Komische Leute gibt das hier. Die haben hier ganz offensichtlich ihren Spaß mit den Touristen“, kam ich zu einer Schlussfolgerung. Bereits am nächsten Tag hatte ich die Geschichte schon fast vergessen, als ich wieder einen Typen im Wasser stehen sah. Und ja, auch er stand dort in dieser merkwürdig reglosen Körperhaltung. Das Schauspiel sollte sich auch an den folgenden Tagen noch mehrfach wiederholen. Einem der Kerle rief ich sogar leicht stichelnd zu: „Na, und? Wie war der Lutschdorsch heute?“ Statt einer Antwort bekam ich einen Daumen rauf gepaart mit einem zufriedenen Lächeln.
Mein Sommerurlaub neigte sich schließlich seinem unvermeidlichen Ende zu, als ich noch ein letztes erfrischendes Bad in der Ostsee nahm. Unbewusst blieb ich auf der letzten Sandbank im bauchnabeltiefen Wasser stehen und ehe ich mich versah, hatte ich auch meine Hände im Nacken verschränkt und starrte regungslos in die Ferne. „Du bist ein Idiot!“, dachte ich, aber etwas in mir verlangte nach Antworten. Und so stand ich da und ich wartete. Kleine Wellen umspülten meinen Körper, das Wasser plätscherte gleichmäßig gegen meinen Bauch, warmer Wind streichelte über mein Gesicht, Möwen kreischten in der Ferne. Das Geplapper der Menschen, das Schreien der spielenden Kinder am Strand, alles trat völlig in den Hintergrund. Ich schloss die Augen und schickte meine Gedanken auf die Reise bis zum Horizont und weiter darüber hinaus. „Ich bin ein Teil des Meeres und das Meer ist ein Teil von mir“, dachte ich und ließ meinen Gedanken freien Lauf.
Auf dem Weg zurück von der Sandbank zum Strand traf ich dann ausgerechnet auf einen der zwei Kerle vom ersten Tag: „Na, mein Freund? Hast du den Lutschdorsch gefunden?“, fragte er mich grinsend. Ich schüttelte nur den Kopf und erwiderte „Ne, verarschen kann ich mich alleine!“ und wandt mich ab, um zügig den Strand zu verlassen. Da hielt mich der Kerl am Arm fest, zwinkerte mir lächelnd zu und sagte: „Ich glaube, du hast ihn schon längst gefunden. Denn du hast über eine halbe Stunde da draußen im Wasser gestanden.“ - „Echt!?“ entgegnete ich überrascht, war ich doch nur ein paar Minuten im Wasser.
Erst als ich schon im Auto saß und sehnsüchtig von der Hügelkuppe zurück auf die Hohwachter Bucht und den Sehlendorfer Strand schaute, verstand ich, was der Sehlendorfer Lutschdorsch ist und was er bei mir bewirkt hat.
- Behauptung: Der Lutschdorsch kann ausschließlich von Männern angelockt werden die „unten ohne“ im Wasser stehen.
Faktencheck durch den Lutschdorsch: „Die verwechseln mich mit dem „Candiru“, auch Penisfisch genannt, den gibt es aber nur im Amazonas und nicht in der Ostsee. Ihr würdet den Unterschied aber auch spüren.“
Spezifisch[1] spricht: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.“ - Behauptung: Der Lutschdorsch wurde 1996 tot am Sehlendorfer Strand aufgefunden.
Faktencheck durch den Lutschdorsch: „Das war Schorsch, ein betagter Tatter-Dorsch, der sein Leben vorsätzlich beendet hat. Er war auf 'Landgang' oder 'frische Luft schnappen' wie wir Fische sagen. [Lutschdorsch lacht] Im übrigen hat das eine DNA Analyse vom Doktorfisch bestätigt.“
Spezifisch spricht: „Der Kiemendeckel sich schnell bewegt, wenn das Leben langsam geht.“ - Behauptung vom Verband deutscher Imbissbuden e. V.: Die Sichtung des Lutschdorsches nimmt mit der Anzahl der verkauften Fischbrötchen zu.
Faktencheck durch den Lutschdorsch: „Das ist natürlich Nonsens und dient lediglich deren Umsatzsteigerung zu Lasten meiner Art.
Spezifisch spricht: „Je mehr Fisch im Brötchen, desto weniger Fisch im Meer.“ - Und NEIN, der Sehlendorfer Lutschdorsch hat natürlich keinen Social Media Account. „So etwas haben Fische nicht.“
[1]Spezi|fisch Substantiv[der], Methusalem-Dorsch, letzter der Altfische, Bewahrer der „Schuppe aus Ursuppe“, oberster Verkünder der Schuppenweisheiten, exekutive Instanz beim Fischgericht. Die „Schuppe aus Ursuppe“ zählt zu den ältesten Fischschuppen, die „Der weise Hai“ noch persönlich in Beißschrift verfasst haben soll. Gläubige Fische tragen stets eine Kopie der Schuppe bei sich. (vgl. Babelfisch 2016, S. 187 ff.)
Der Lütjenburger Scharfrichter
Der Scharfrichter ist durch Erzählen von Generation zu Generation noch in der Erinnerung der Lütjenburger lebendig. Bis zum Sommer 1955 wohnte noch eine Familie hier, deren Mann ein direkter Nachkomme des letzten Lütjenburger Scharfrichters ist. Er besitzt noch Papiere aus der Scharfrichterzeit, die durch Erbschaft auf ihn gekommen sind.
Zweierlei ist noch besonders bekannt. Er hat in Gieschenhagen, und zwar in dem Häuschen gewohnt, das an Nr. 13 jetzt die Landwirtschaftliche Ein- und Verkaufsgenossenschaft gebaut ist. Und dann wird noch erzählt, wie sein Trinkgefäß im Krug an einer Kette fest war und der Gastwirt es ihm hinausreichte, wenn er Bier oder Schnaps trinken wollte.
Interessant ist auch, was vom Verhältnis des Scharfrichters zur Kirche zu berichten ist. In der Kirche hatte er einen besonderen Platz auf der Empore. Dort trug sich nun am 1. Pfingsttag 1661 ein Skandal zu, der nicht nur in der Geschichte der Lütjenburger Kirche einzig dastehen dürfte. Diesen mußte ausgerechnet P. Glumann erleben, dem das Zeugnis ausgestellt wird, daß er in Lütjenburg Ordnung im Kirchen- und Schulwesen geschaffen hat.
Nur etwas verkürzt und von altertümlichen Wendungen befreit, soll hier Glumanns Bericht folgen über das, was geschehen ist:
Anno 1661 am 1. heiligen Pfingsttage kam unser Scharfrichter, Meister David Möller, zur rechten Zeit in die Kirche, ging die Treppe hinauf und setzte sich auf seinen Platz. Bald danach kamen auch drei volle Bauernknechte, welche den Scharfrichter überlaut, daß man's unten hören konnte, anschrien: „Heraus, Schinder! Heraus, Schinder!", langten auch nach seinem Kopf, um ihn mit Gewalt hinunterzustoßen. Nach dem ersten Schreck zog dieser seinen Degen, um sich zu schützen. Als man unten den Degen blinken sah, erhoben Männer und Frauen lautes Geschrei, die in großen Haufen nach dem Chor liefen; so viele konnten, stiegen die Treppe hinauf, rissen dem Scharfrichter den Degen aus der Hand und hielten die drei Urheber fest, daß sie nicht an den Scharfrichter heran konnten. Der Scharfrichter wurde vom Chor und aus der Kirche gebracht. Tumult und Geschrei dauerten etwa eine halbe Stunde, während der man Singen und Orgelspiel unterlassen mußte, da beides nicht zu hören war. Nun begann man wieder mit dem Gottesdienst, hatte aber erst drei Verse vom Magnificat gesungen mit was für Andacht, ist leicht zu ermessen, da noch „ein groß gedöne und murmeln in der Kirche" war, da kam der Scharfrichter wütend wieder in die Kirche, hielt zwei geladene Pistolen in die Höhe, lief damit die Treppe hinauf und wollte den drei Knechten zu Leibe. Da liefen alle Leute aus ihren Stühlen nach dem Chor, mit lauten Verwünschungen und Schreien ward ein Gedränge, daß man nicht stehen konnte. Sie hielten den Scharfrichter, daß er kein Unheil anrichten konnte, der aber drängte sich hinaus auf den Kirchhof. Die Bauernknechte, die auch aus der Kirche wollten, wurden umringt und nicht losgelassen, in der Meinung, daß die beiden Herren Bürgermeister, die dabeistanden, sie gefangennehmen sollten. Diese erklärten aber, die drei könnten sie doch nicht festhalten. Als diese aber auf den Kirchhof kamen, stand dort der Scharfrichter und wartete auf sie. Darauf begann eine Schlägerei mit Fäusten eine halbe Stunde lang. Alles Volk lief aus der Kirche, jeder in sein Haus, und der Gottesdienst am heiligen Pfingstfest mußte ausfallen und des Teufels Werk vorgehen. Gott sei es geklagt!
Dieser Bericht ging als Beilage mit einer Anklageschrift an die Kgl. Regierung. Eine endgültige Antwort ist nicht vorhanden, aber aus Glumanns Eingabe, zwei Briefen des Scharfrichters, einem Brief der Stadt und einer kurzen Regierungsverfügung ist folgendes zu entnehmen:
Die Stadt sollte auf Regierungsbefehl den Scharfrichter etliche Tage ins Gefängnis einsperren und ihn mit einer für ihn tragbaren Geldstrafe belegen. Sie hatten ihn 22 Tage auf dem Rathaus, aber nicht im Gefängnis und verurteilten ihn zu 45 Reichsthaler Buße. Die Bürgermeister schickten den Sekretär zum Pastor und ließen ihm sagen, sie hätten den Scharfrichter bestraft, jetzt solle der Pastor ihn ohne öffentliche Kirchenbuße zum heiligen Abendmahl zulassen, sonst würden sie ihn bei der Regierung verklagen.
Ebenso verbot Seine Hochadeliche Gestrengigkeit Herr Hinrich Blome, Rittmeister der königlichen Majestät Raths- und Amtmann zu Rendsburg, mein hochgeehrter Herr Compatronus, dem Neversdorf gehörte und dessen Leibeigene die drei Knechte waren, daß sie sich keiner Kirchenbuße unterziehen sollten. Zu P. Glumann schickte Blome seinen Verwalter und ließ ihm gebieten, daß er seine Knechte (ohne daß sie irgendwie bestraft waren) ohne Kirchenbuße zum heiligen Abendmahl zulasse, sonst werde er ihn beim König verklagen.
P. Glumann beruft sich auf die Kirchenordnung und auf den ausdrücklichen Befehl des Generalsuperintendenten Dr. Reinboth, der drei Wochen nach dem Skandal in Lütjenburg Kirchenvisitation gehalten hatte, wonach der Pastor keinen der Gottesdienststörer ohne weiteren Bescheid zum heiligen Abendmahl lassen dürfe.
P. Glumann beruft sich auf seine fast 45jährige Dienstzeit und fragt, ob die Kirchenordnung noch gelte.
Der Scharfrichter schreibt, er habe gehorsam seine Gefängnisstrafe abgesessen und auch 20 Rthl. an Geldbuße gegeben. Seine Frau wäre damals in den letzten sechs Wochen der Schwangerschaft gewesen und so erschrocken, daß sie erkrankt und das Kind gestorben sei. Die Urheber des Streites seien nicht bestraft worden.
Im zweiten Brief berichtet er, daß der Rat der Stadt noch 30 Rthl. von ihm haben wolle. Er könne das nicht bezahlen, da wir drei kleine Kinder haben und meine Frau jetzt wieder Kindbett hält".
Die Stadt schreibt, der Scharfrichter lüge, er solle noch 25 Rthl. zahlen, und das Kind sei schon tot gewesen, als er sitzen und zahlen sollte.
Die Regierung ordnet unter dem 17. Januar 1662 an, daß die anderen übeltäter ebenfalls mit Gefängnis und Geldbuße nach ihrem Vermögen zu bestrafen seien.
Weiteres ist uns in den Akten nicht aufbewahrt. Fritz Seefeldt
Alle Akten liegen im Schleswiger Staatsarchiv unter A III 1853, in Abschrift auch im neuen Pfarrarchiv unter „Gottesdienst".
Steäf und Skild
In alten Zeiten, als noch wenige Menschen hier im Lande lebten, trieb einmal ein Schiff ohne Steuer und Rudet die Schlei herauf: darin lag ein eben geborner Knabe, nackt und schlafend, mit dem Kopfe auf einer Garbe; um ihn her waren Waffen aller Art und viel edles Geschmeide hingelegt. Niemand kannte ihn und wusste woher er gekommen sei; aber man nahm ihn wie ein Wunder auf, pflegte und erzog ihn, die er erwachsen war, und weil man glaubte, daß ein Gott ihn gesendet habe, und die Herrlichkeit des Jünglings sah, wählte man ihn zum ersten Könige über die Angeln und nannte ihn Skeaf oder Schoof, weit man ihn schlafend auf einem Schoof, einem Bündel Stroh, gefumden hatte. Skeaf aber wohnte an dem Orte, der von altersher Schleswig heißt umd herrschte lange Zeit ruhmvoll über sein Volk.
Sein Sohn hieß Skild, d. i. Schild. Dem mussten bald alle Anwohnenden gehorchen; seinem Volke war er ein lieber Landesfürft. über lange blieb er ohne Nachkommen, bis ihm im hohen Alter Beowulf oder Beaw geboren ward. Dessen Ruhm verbreitete sich schnell in den Skedelanden zwischen den beiden Meeren.
As dem alten Könige nun das Schicksal nahte und er dahin ging, brachte sein Gesinde die theure Leiche zum Ufer, wie er selbst befohlen hatte, da er noch lebte. Zur Ausfahrt stand sein Schiff bereit, glänzend wie Eis: da hinein legten sie trauernd den Fürsten, mit dem Haupte zum Maste. Kein Schiff war je prächtiger ausgerüstet: eine Menge von Schätzen und Kleinoden, Waffen und Kriegsgewändern lagen umher, wie einst in dem Schiffe, das den Steaf zu Lande getragen hatte. Hoch an den Mast band man ein güldnes Banner als königliches Zeichen und überließ es dann steuerlos dem Spiel der Fluthen. Von nun an herrschte Beowulf über die Lande seines Vaters und ward durch feine zahlreichen Söhne Stammwater aller edlen Geschlechter, die einst nicht nur bei den Angeln blühten, sondern auch bei den Gothen, Wandalen, Schweden, Dänen, Norwegen, Züten, Friesen und Sachsen,
bei allen den Völkern, die einst an Ost- und Westsee wohnten.
Anekdote vom alten Fürsten von Hessenstein
Der Generalfeldmarschall Fürst Friedrich Wilhelm von Hessenstein, von 1781 bis 1808 Besizer der Güter Panter, Hohenfelde, Klampe und Schmoel, scheint, wenigstens in seinen alten Tagen, ein etwas eigenartiger Herr gewefen zu sein. Von seinen Sonderbarkeiten wußte man in der Lütjenburger Gegend vor sechs Jahrzehnten noch allerlei zu erzählen. Unter andern hörte ich derzeit auch die folgende Anekdote.
Der Fürst war sehr schweren Leibes und hielt es daher seinem Wohlbefinden für zuträglich, sich dann und wann etwas Bewegung zu gestatten. Mit zwei Dienern, zur Wegbereitung jeder mit einem Brett ausgerüstet, trat der alte Herr die Wanderung an. Während er an Hand des Dieners und auf seinen derben Eichenstock gestützt ein Brett bedächtig hinabwandelte, legte der andere Diener sein Brett wieder vor. Das Ziel war die Bauervogtshufe im nahen Gadendorf. Auf der „Großen Diele" angelangt, erhob der alte Herr den Blick zum Räucherwiemen (Rauchfang) und sprach so für sich hin: Schinker, Schinker, Schinker?" Der Bauer kam ihm schon entgegen und fragte: „Ja, will de Herr Fürß Schinken eten?" Die stehende Antwort war: „Hat Er Pfeffer? Sonst laß Er was holen!" In der Stube führte der Herr Fürst sich dann am sauber gedeckten Tisch ein Frühstück von eigengebackenem Schwarzbrot mit Butter und Schinkenscheiben zu Gemüte, zu dessen Beförderung dann noch ein Glas im Hause gebrautes Bier und einige Schnäpse Lütjenburger Korn genehmigt wurden. Durch Kraft dieser Speise und auf die geschilderte Weise ging es dann nach Panker zurück. Der Bauernvogt aber stand sich nicht schlecht bei dieser gelegentlichen Bewirtung: Am Zahltag pflegte die Pachtsumme mit einem Federstrich beglichen zu werden. Richard Johannsen.
Alter Glaube in Ostholstein
Den Abend vor Johannestag gehn die jungen Burschen und Mädchen nach ihrem wachsenden Flachs und stecken grüne Zweige dazwischen, glaubend, der Flachs solle so lang wachsen, wie die darin gesteckten Büsche. In der Johannesnacht soll ein Thier, fliegender Krebs genannt, umherschwärmen und alles draußen gebliebene Zeug und anderes Leinen vergiften, so daß derjenige, welcher sich mit dem Zeuge bekleidet, auch selber einen Krebsschaden bekommt, daher niemand Zeug in dieser Nacht draußen läßt. Die in dieser Nacht gepflückten Kräuter, wie Flieder, Kamillen p. p., sollen noch mal so viel medicinische Wirkung thun, wie zu andrer Zeit gepflückte Kräuter. Wenn ein Fruchtbaum beraubt ist, wird er nicht leicht wieder tragen; man muß ihn daher am Neujahrsabend mit einem Stück Geld beschenken, d. h. dasselbe in seine Rinde stecken, nachdem wird er wieder tragen. Wenn Milch ins Feuer focht, trocknen die Kühe, von welchen dieselbe genommen ist, auf. - Wird ein Kind schief oder krumm wachsen, so soll man am Ostermorgen eine junge, schiere Eiche aufspalten und bei aufgehender Sonne das nackende Kind stillschweigend dreimal hindurchziehen, dann wächst es sich gerade. - Wenn jemand Warzen hat, so soll er mit der Hand von einem Todten dreimal stillschweigend darüber streichen, so vergehen dieselben. - Wenn eine Leiche zu Grabe gefahren wird, muß der Wagen ungeschmiert bleiben und die Folger dürfen ihr Fußzeug nicht frisch geschmiert haben. Auch darf der Fuhrmann sich nicht umsehen bei der Hinfahrt. Ist der Wagen wieder zu Hause angekommen, wird er gleich von einander genommen. Unterließe man dieses, würde der Todte wiederkommen." Aus Niederschriften von Verwalter Jürgens auf Schmoel (um 1830).
Die „witten Wiewer“ im Voßberge
Geht man des Weges von Neudorf nach Schmiedendorf, so kommt man an einem Hünengrabe, dem Voßberge, vorbei, in welchem vor vielen, vielen Jahren die Unterirdischen (de Uennereerschen), auch merkwürdigerweise die „weißen Weiber“ (de witten Wiewer) genannt, ihr Wesen trieben. Es waren aber im Voßberge nicht, wie der Name vermuten läßt, bloß Weiber, sondern auch Männer unter ihnen. Einst waren sie ganz normale Kinder - aber dank ihrer Mutter versanken sie im Erdreich, so erzählt man sich. Diese Unterirdischen waren kleiner als die Menschen. Sie konnten sich unsichtbar machen und sich in allerlei Tiergestalten verwandeln. Ihre Lebensbedürfnisse holten sie aus dem Felde, den nächsten Dörfern oder aus Lütjenburg. Das siebente Gebot war ihnen entweder unbekannt, oder sie nahmen es mit demselben nicht so genau. Einen Raub an ihrem Eigentum durch die Menschen nahmen sie jedoch sehr übel. Sie verschafften sich übrigens auch auf ehrliche Weise ihre Bedürfnisse. Erzählt aber wird folgendes von ihnen.
Der gedeckte Tisch
Es war noch zur Zeit der Leibeigenschaft, als der Hunger noch ein viel bekannterer Gast war, als er es jetzt ist, pflügten Neudorfer Leute am Voßberg auf der Koppel. In der Nähe des Berges duftete ihnen der Geruch von frischem Brot entgegen, und einer sprach zum andern: „Gewiß hebbt de witten Wiewer backt; wenn wi man ok wat to eten harrn!“ Sogleich stand vor ihnen ein fein gedeckterTisch, mit den schönsten Speisen besetzt. Es waren soviele Teller und silberne Messer und Gabeln auf dem Tische, als Leute auf der Koppel arbeiteten. Alle setzten sich heran und aßen sich satt. Einer der Pflüger aber entwendete eine Gabel vom Tische und steckte sie in die Tasche. Nach der Mahlzeit wollte deshalb der Tisch nicht verschwinden, wie es sonst wohl geschehen wäre. Die Leute wunderten sich darüber, und der Vogt sagte: „Ei, wo geiht dat to, de Disch will ja nich werrer weg!“ Alle Taschen wurden durchsucht, die Gabel wurde gefunden und an ihren Platz gelegt. Im Nu war auch der Tisch fort. Von der Zeit sind nie wieder Leute am Voßberg von den „witten Wiewern“ gespeist worden.
Musik im Voßberge
Ein anderes Mal kamen nachts Mädchen am Voßberge vorbei. Sie waren auf Neudorf zum Erntebier gewesen und jetzt im Brgriff heimzukehren. Vor dem Berge angekommen, scholl ihnen aus demselben eine wunderliebliche Musik entgegen. Wie es denn so jungen Mädchen geht, wenn sie eine lustige Musik hören, so ging es auch diesen, sie fingen im Wege zu tanzen an. Die „witten Wiewer“, welche vermutlich eine Hochzeit feierten, nahmen dies übel. Mit einem Male sprangen einige kleine Kerle aus dem Berge und hieben mit glühenden Stangen auf die Mädchen los. Die Mädchen eilten mit Geschrei davon, die Kerle hinter ihnen her. Von ungefähr aber kam der Neudorfer Nachtwächter des Weges. Als dieser das Geschrei der Dirnen hörte, fing er an zu donnern und zu fluchen. Die „witten Wiewer“ waren verschwunden.
Der Bierholer
In Lütjenburg war damals ein Wirtshaus, Senator Gädes Brennerei, aus welchem ein Unterirdischer Abend für Abend Bier holte. Den Unterirdischen sah niemand, die Kanne aber war jeden Abend da, und das Geld lag darauf. Die Leute im Wirtshaus wußten Bescheid; sie nahmen das Geld und setzten die Kanne gefüllt an ihren Platz. Darauf ging die Tür wieder auf und zu, und das Bier war fort. So ging es einen Abend wie den andern, jahraus, jahrein. Eines Abends aber, als soeben wieder die Kanne angekommen war, rief mit einem Male eine klägliche Stimme: „Komm, Balbel, komm, Balbel, komm, Balster is dod!" Darauf anwortete eine andere Stimme: „35 Balster dod, is Balster dod, denn sünd wi all in grote Not!" Balbel war der Name des Unterirdischen, der das Bier holte. Dem brachte ein anderer Unterirdischer die Nachricht von dem Tode Balsters (ihres Königs?). Balbel ließ vor Schrecken die Kanne stehen. Wie die Leute erzählen, soll die Kanne noch heute im Besitz des Wirtshauses sein.
Das Wochenbett im Voßberge
Zu damaliger Zeit wohnte auf Hufe in Schmiedendorf (Hufe der Ww. Bünsen) eine Bauerfrau, welche zugleich die Hebammenkunft verstand. Diese Frau lag eines Tages mit ihrer Magd in ihrem Garten auf einem Wurzelbeet, um es vom Unkraut zu reinigen. Während sie jäteten, kam bei ihnen eine scheußliche Kröte (Breddfot) angekrochen. Das Mädchen sprang auf, das Untier zu töten, die mitleidige, weichherzige Hausfrau jedoch verbot ihr dies. Die Kröte aber war ein verwandelter Unterirdischer. Nach einiger Zeit wurde die Frau von einem Unterirdischen nach dem Voßzberge geholt. Der Berg tat sich auf. Die Frau wollte eintreten, schrak aber zurück, als sie über dem Eingang einen Mühlstein an einem seidenen Faden hängen sah. Wie leicht konnte nicht der Faden reißen und sie durch den schweren Mühlstein erschlagen werden. Ihr Führer aber sagte ihr, fie möge nur getrost eintreten, der Faden werde nicht reißen, weil sie die Kröte beschützt habe. Hätte sie die Kröte getötet, so würde sie beim Eintritt von dem Mühlstein erschlagen worden sein. So wie das Leben der Kröte an einem seidenen Faden gehangen habe, so hänge jetzt ihr Leben an einem seidenen Faden. Im Voßzberge wurde glücklich ein Kindlein geboren. Bei der Geburt des Kindes erhielt die Frau eine Kruke, aus welcher sie dem Kinde ein wenig Salbe unter die Augen wischen mußte. Ohne daß die, „witten Wiewer“ es merkten, wischte auch sie sich von der Salbe unter die Augen. Beim Abschied erhielt sie eine Schürze voll Hobelspäne als Lohn, mit der Weisung, diese in ihrer besten Lade zu verwahren. Sie wunderte sich über das geringfügige Geschenk, dachte aber als sparsame Hausfrau: „Du kannst de Spön je mitnehmen un dar morgen fröh Füer mit anmaken". Zu Hause angekommen, warf sie die Hobelspäne auf den Herd in eine Ecke und ging zu Bett. Am andern Morgen aber fand das Mädchen, welches zum Feueranmachen von der Frau geweckt worden war, nicht Hobelspäne sondern lauter blanke Geldstücke. Schnell lief sie zu ihrer Herrin, um dieser mitzuteilen, welche Verwandlung auf dem Feuerherd vor sich gegangen sei. Diese aber sagte: „Swieg man blots still!" raffte das Geld zusammen und verwahrte es in ihrer besten Lade. Von der Salbe hatte die Frau die Fähigkeit bekommen, die Unterirdischen zu sehen und zu erkennen, wenn sie anderen Menschen unsichtbar waren. Eines Tages stand fie auf dem Dorfe, da, wo der Neudorfer Weg in die Lütjenburg-Oldenburger Landstraße mündet, und sah zwei Unteridische, welche mit einer Schiebkarre voll Speck von Futterkamp her in den Neudorfer Weg einbogen. „Wonem kamt ji denn al her?" redete die Frau sie an. Sühst du uns?" lautete die Gegenfrage. Die Frau antwortete: „Warüm schull ik ju nich sehn können?" Sogleich sprangen die beiden Unterirdischen auf die Frau los und spukten sie dreimal an. Weg waren sie!
|
Das Flensburger Feuerschiff |
|
|
| |
|
De Bottermelkskrieg to Lüttenborg Dat wer in April 1848. |
|
|
Ekke Nekkepenn (urspünglich Eie oder Eike) ist der nordfriesische Meeresgott. Laut Christian Peter Hansen (1803–1879) ist er durch alte Erzählungen der Sylter Heidebewohner überliefert. Danach soll er genau wie seine Gemahlin Ran eine hässliche walrossähnliche Gestalt gehabt haben. Das kümmerte ihn jedoch wenig, im Gegenteil, er kam von Zeit zu Zeit an Land, um hübschen Mädchen nachzustellen. Derweil saß seine Frau am Meeresgrund und mahlte Salz, wovon die Nordsee so salzig geworden ist. Manchmal mahlte sie so heftig, dass ganze Schiffe in die Tiefe gerissen wurden. Zur Besänftigung der Meeresgötter benannte man die Siedlungen Eidum (Eie) und Rantum (Ran) nach ihnen. Das war offensichtlich ein Fehler, denn mit Sturmfluten und Flugsand holten sie sich nun ihr vermeintliches Eigentum. Eidum ging in der Allerheiligenflut 1436 unter, und bald darauf wurde das alte Rantum unter Dünensand begraben. In einer anderen Sage gerät Ekke Nekkepenn in eine Geschichte, die stark rumpelstilzchenhafte Züge trägt: | |
|
Ekke Nekkepenn - eine Meerjungfrau und ein Meermann Der Meermann namens Ekke Nekkepenn lebte tief unten am Grund der Nordsee. Er lebte dort mit seiner Frau. Ihr Name war Rahn. Als Rahn einstmals in den Wehen lag, musste Ekke Nekkepenn sich große Sorgen machen, ob des Lebens des noch ungeborenen Kinds und des Lebens seiner Frau. Selbst wusste er ihr nicht zu helfen. So schwamm er an die Oberfläche der stürmischen See. Dort hatte er ein Schiff entdeckt, das auf seinem Weg mit den hohen Wellen zu kämpfen hatte. Er bat die Leute auf dem Schiff um Hilfe, und die schöne Frau des Kapitäns war bereit der Frau des Meermanns bei der schweren Geburt beizustehen. Als die Geburt mit Hilfe der Menschenfrau geglückt und Rahn so wie das kleine Meerkind wohlauf waren, da überhäufte Ekke Nekkepenn die hilfsbereite Frau zum Dank mit Silber und Gold, und der Meermann machte, dass der Sturm sich legte. So konnten die Seeleute ihre Heimreise nach Rantum auf Sylt bei ruhiger See fortsetzen. |

♫ „Heute soll ich brauen, |
|
Als der Meermann dann am vereinbarten Ort ankam, da sagte Inge ihm: „Du heißt Ekke Nekkepenn und ich bleib Inge von Rantum.“ Seitdem soll der Meermann den Syltern alles andere als wohlgesonnen sein. Er lässt ihre Schiffe im plötzlich aufziehenden Sturm kentern und spült mit der Flut den Sand von ihrer Insel fort. Rantum musste in den letzten tausend Jahren tatsächlich mindestens dreimal nach Osten verlegt werden. | |
Lütjenburger Originale – Der Adolfsnieder
Schon wie er daherkam, der Adolfsnieder aus Satjendorf, und mit seiner Hundekarre musizierend durch die Straßen Lütjenburgs trottete! Auf seiner Mundharmonika spielte er seltsame Weisen, die niemals eine bestimmte Melodie, wohl aber ein schrulliges Klanggemüse verlautbarten. Er hatte seinen erlernten Beruf als Dorfschneider an den Nagel gehängt, um sich dem ambulanten Käsehandel zuzuwenden. Als Rest des Fundus seiner handwerklichen Vergangenheit mochte ein alter grünbemooster Gehrock gelten, der ihn zu einem „Obenschmal“ und „Untenbreit“ einhotzelte. Ein alter, zerquetschter Hut bevorzugte bei Hitze den Sitz auf dem hageren Hinterkopf, bei Schnee und Hagel die Nasenspitze. Und der untere Teil seiner Hose verbarg schamhaft ein Paar arg abgelatschter Dreiviertelstiefel, denen Adolf keine Gelegenheit zum Sterben gönnte. Die Käselaibe, die er mithilfe seines schwarzen Hundes in der Karre umherrollte, stammten aus Gutsmeiereien der Probstei und verrieten augenscheinlich die Auferstehung aus einer langen Vergrabung, denn sie waren reif für ihr kulinarisches Ende. Dieser Käse, der, mit Kümmelkörnern versetzt, bläulich und glasig im Schnitt, auch stark duftete, war besonders bei kinderreichen Müttern sehr begehrt, weil er zugleich „billig mit Millich“ war. Sie ließen sich darum gleich ganze Hälften abschneiden. Wenn Adolf dann mit seinem gewaltigen Messer in die Laibe hineinstieß, murmelte er fortwährend vor sich hin: „O ja, god is de Käs. De Käs is god!“
Lütjenburg war zu keiner Zeit seiner Vergangenheit ohne Originale.
Die Schwarze Grete: Frau eines Dänen-Königs als Vorbild
Oft gehen Märchen, Legenden und Sagen auf wahre Menschen zurück. So gibt es die Geschichte der Schwarzen Grete. Sie soll auf die Frau des dänischen Königs Christoph des Ersten im 13. Jahrhunderts zurückgehen. Weil sie eigensinnig und sehr stark gewesen sein soll und obendrein mit dem Teufel im Bunde, wurde sie nach ihrem Tod zum Geist.
Die schwarze Greet und die Fischer
Zwei arme Fischer, die auf dem Schleswiger Holm wohnten, hatten die ganze Nacht vergeblich gearbeitet, und zogen zum letztenmal ihre Netze wieder leer herauf. Als sie nun traurig heimfahren wollten, erschien ihnen die schwarze Greet, die sich öfters den dortigen Fischern zeigt; sie kommt vom andern Ufer her, wo eine Stelle im Dannewerk in der Nähe von Haddebye nach ihr Margretenwerk heißt, und erscheint in königlicher Pracht mit Perlen und Diamanten geschmückt, aber immer im schwarzen Gewande - ganz so, wie sie früher auf dem Husumer Schloß im sogenannten Margretensaal zu schauen war. Die sprach zu den Fischern: »Legt eure Netze noch einmal aus, ihr werdet einen reichen Fang tun; den besten Fisch aber, den ihr fangt, müßt ihr wieder ins Wasser werfen.« - Sie versprachen es und taten, wie die Greet gesagt; der Fang war so überschwenglich groß, daß ihn der Kahn kaum fassen wollte. Einer der Fische aber hatte Goldmünzen statt der Schuppen, Flossen von Smaragd und auf der Nase Perlen. »Das ist der beste Fisch«, sprach der eine, und wollte ihn wieder ins Wasser setzen. Aber der andre wehrte ihm und versteckte den Fisch unter den übrigen Haufen, daß die Greet ihn nicht sähe; dann ruderte er hastig zu, denn ihm war bange. Ungern folgte ihm sein Gefährte. Aber wie sie so hinfuhren, fingen die Fische im Boote allmählich an zu blinken, wie Gold, denn der Goldfisch machte die übrigen auch golden. Und der Nachen ward immer schwerer und schwerer, und versank endlich in die Tiefe, in die er den bösen Gesellen mit hinabzog. Mit Not entkam der andre und erzählte die Geschichte den Holmer Fischern.
Die schwarze Greet am Dannewerk
Gott straft die alte Königin Margret so für ihr ruchloses Leben, daß sie keine Ruhe im Grabe hat und in jeder Nacht über den alten Wall, den sie mit Hilfe des Teufels gebaut hat, hinreiten muß. Das haben viele Leute gesehen. Oft kommt sie auch Mittags zwischen zwölf und ein. Sie trägt stets ein schwarzes Kleid, reitet auf einem weißen Rosse, das Dampf und Feuer aushaucht; ihr nach folgen zwei andere Geister in schneeweißem Gewande. So macht sie jedesmal die Runde in vollem Rennen von Hollingstede bis Haddeby. – Einmal war eine Magd ausgeschickt, an dem Walle Kartoffeln auszugraben; es war Mittags um zwölf. Da kam sie plötzlich nach Hause gesprungen und schrie, die schwarze Greet sei ihr vorbeigesaust und ihre Begleiter seien auf sie losgekommen. Da habe sie den Kartoffelsack im Stich gelassen und sei davongelaufen. Als man nun hinging und nachsah, fand man die Kartoffeln umhergestreut und zertreten. Das hatte aber die schwarze Greet getan, weil sie nicht will, daß auf ihrem Wall gebaut werden soll.
Noch in der Neujahrsnacht des Jahres 1844 geschah es, daß die Kinder der Leute, die bei Kurburg am alten Walle wohnen, Abends spät nach elf von der Nachbarschaft nach Hause gingen. Da kam ihnen auf dem Walle das weiße Pferd entgegen, mit einem weißen Laken behangen, große Klunker an den Ohren, mit einer Laterne vor dem Kopf, es gab Dampf von sich, und darauf saß eine hohe schwarze Gestalt. Das war die Greet. Zwei andere weiße Gestalten folgten ihr zu Fuß. Die Mädchen liefen eilig ins Feld, da sauste das Pferd weiter den Wall entlang, aber die weißen Gestalten verfolgten sie. Die Mädchen waren in großer Not. Die kleinste fiel und fing an zu beten, die andern kamen davon. Als nun die Eltern die Kleine nach Hause holten, konnte sie kein Wort reden, als: »Das Pferd! das weiße Pferd!« Noch mehrere Tage redete sie irre, und als der Vater diese Geschichte erzählte, ward ihr wieder ganz angst und sie hielt die Hände vors Gesicht, war auch auf keine Weise zu bewegen, etwas davon zu erzählen.
Die Schwarze Greet prophezeit
Als einmal die schwarze Greet Bornhöved, das damals eine große Stadt war, belagerte, sagte sie, sie wolle die Stadt so gewiß einnehmen und verstören, wie ihr Pferd seine Spur in einen daliegenden Stein haue. Das Pferd schlug die Spur in den Stein, und sie erfüllte ihren Schwur und nahm die Stadt ein. Der Stein lag noch vor einiger Zeit auf dem Bornhöveder Felde. Jetzt ist er in die Wand eines Bauernhauses vermauert; die Spur des Pferdehufs war aber ganz deutlich darin abgedrückt. Die schwarze Greet hat auch geweissagt von einem Könige lang nach ihrer Zeit, der werde Krieg führen solange bis er alle seine Leute soweit verloren hätte, daß ihm nur die zwölfjährigen Knaben im Lande übrig blieben. Mit diesen werde er bei Nortorf eine große Schlacht gewinnen und dabei sein Pferd an einen Ellhorn binden, der unter der Kirche heraus wachse. Man sagt auch von dem Hollunderbaum an der Nortorfer Kirche, daß er gar nicht zu verhaten (verwüsten) sei.
Jugend- und Volksspiele - Der Läuferball
Im Dorfe Kuden in Süderdithmarschen wurde in den 1860ger Jahren ein eigentümliches Volksfest gefeiert, das wie so manches dieser Art der Neuzeit längst gewichen ist der Läuferball. Es war hauptsächlich ein Fest für Unverheiratete und wurde an einem Sonntagnachmittag während des Sommers gefeiert. Die Vorbereitungen waren einfach. Zum Laufen meldeten sich ein gewandter junger Mann (Knecht) und zehn Mädchen. Auf einem möglichst geraden und geebneten Wege wurde eine Strecke von 100 Ruten Länge bezeichnet. Der Läufer nahm am Anfang der Strecke seine Aufstellung, auf einem Punkte von je 10 Ruten Abstand stand ein Mädchen. Das erste Mädchen, mit dem Läufer am ersten Punkte stehend, trug ein Taschentuch. Nachdem alle Aufstellung genommen, begann auf ein gegebenes Zeichen der Wettlauf. Während der Läufer die ganze Strecke von 100 Ruten zu durchlaufen hatte, durchlief jedes der zehn Mädchen eine solche von 10 Ruten. Zur Kontrolle mußte das erste Mädchen das Taschentuch an das zweite, dieses an das dritte u. s. w. geben. Außerdem hatte der Läufer in der Mitte, also beim 5. Punkte noch in der Geschwindigkeit einen Schnaps zu trinken. Wer zuerst am Endpunkte anlangte, hatte gesiegt. Die Verlierer hatten dann eine Bowle Punsch zu liefern, welche im Wirtshause unter allgemeiner Heiterfeit getrunken wurde. Mit dem üblichen Tanz fand das Fest unter großer Beteiligung seinen Abschluß.
Die Braut bittet um Federn zum Brautbett
Ende der 30 er und Anfang der 40 er Jahre war es in den Dörfern westlich und südlich von Schleswig Sitte, daß eine (doch wohl nur wenig bemittelte) Braut umher ging, Federn zum Brautbett zu erbitten. Irgend eine alte Frau übernahm als ,,Brautmutter" in solchem Falle die Begleitung und die Wortführung. Sie erschien dann mit einer Kissenbüre zur Aufnahme der Federn, stellte die Braut vor und sprach in stereotyper Form ihre Bitte aus. Nach einigen, oft scherzenden und derben Fragen an die Braut wurde stets die Bitte bewilligt, entweder durch Ver- abreichung einer Handvoll Bettfedern oder einiger Schillinge. - Nicht selten machte die Alte mit ihrer sonntäglich gekleideten Braut die Runde durch mehrere Dörfer. Hoffentlich ist diese, für ein junges Mädchen recht peinliche Sitte, jezt längst aufgehoben. J. J. Callsen.
Die Wochentage in ihrer Beziehung zum Volksglauben
Wie der alte Volksglaube im allgemeinen, so schwindet auch die Bedeutung unserer Wochentage im Volksglauben mehr und mehr.
Den Sonntag brachten unsere heidnischen Vorfahren in Beziehung zur Sonne. Er war daher ein guter Tag und gilt noch heute als ein Glückstag. Der am Sonntag Geborene, das Sonntagskind, wird einen besonders glücklichen Lebenslauf haben und ist auch ein Hellseher. Der Sonntag ist ein willkommener Gast nach den Tagen schwerer Arbeit, und sorglos genießt die Jugend seiner Freuden. „Sünndags hinkt'r keen Jungs.“
Auch das einfachste Hauswesen verrät den festlichen Charakter dieses Tages. „Bitt'n witt Sand vör de Dör un 'n bitt'n Krut an de Supp, sünst ist keen Sünndag!“ pflegte Großmütterchen zu sagen.
Die gewöhnliche Tagesarbeit, auch die Handarbeit des weiblichen Geschlechts, muß an diesem Tage ruhen. Wer dagegen frevelt, den wird der göttliche Zorn treffen. Einst traf der liebe Gott einen Mann, der am Sonntag Holz sammelte. Da sprach er zu ihm: „Weißt du nicht, daß heute Sonntag ist? Hast du nicht an den andern Tagen Zeit genug, Holz zu sammeln?“ Der Mann wollte sich damit entschuldigen, daß ihn die Not dazu getrieben habe, aber der liebe Gott sprach: „Du sollst zur Strafe ewig mit deinem Bündel im Monde sitzen," und da sieht man ihn noch heute.
In Dithmarschen erklärt man die Figur im Monde als eine Spinnerin, die den Feiertag nicht geheiligt hat.
Wer auf seinem Sterbelager mit einem Hemde bekleidet ist, das an einem Sonntage genäht wurde, der findet nicht eher ein ruhiges Ende, bis man einen Teil von der Naht im Hemde aufgetrennt hat.
Sogar die emsigen Bienlein haben Gottes Strafe fühlen müssen, als sie in ihrem Eifer nicht des göttlichen Gebotes achteten und auch am Feiertage den süßen Honig einsammelten. Denn den süßesten Saft legte der liebe Gott in eine Blume mit langer Röhre, daß die Bienen ihn nicht zu erreichen vermögen. Es ist Lonicera Peiclymenum L. (Waldgeißblatt), vom Volke „Sugblomen“ oder „Sugrank'n“ genannt, weil die Kinder gerne den süßen Saft heraussaugen.
Den Montag brachten unsere Vorfahren in Beziehung zum Mond, und aus der Veränderlichkeit des Mondes dürfte der Glaube abzuleiten sein, daß man am Montage nichts beginnen darf, was Bestand haben soll. Daher wohl auch die Redensart: „Fulen Maandag gift'n fliedige Wek!“ oder: „Fliedigen Maandag gift'n fule Wek!“ Wenn das Gesinde am Montag seinen Dienst antritt, wird es nicht „wekenölt“, d. h. es hält den Dienst nicht eine Woche lang aus. Früher gestattete die sorgsame Mutter auch nicht, daß ihre Lieblinge am Montag den ersten Schulgang antraten. Vom Montag heißt es auch: „Wenn man am Montag Gäste hat, so hat man in der ganzen Woche Gäste zu erwarten.
Der Dienstag war bei den alten Germanen dem Kriegsgott Ziu (alt= nordisch Tyr) heilig, daher die Namen Zistag, Distag. Der deutsche Name „Dingsdag“ ist von Ding (Gericht) abzuleiten, das an diesem Tage abgehalten wurde. Er gehört zu den guten Tagen.
Der Mittwoch ist der Tag Wodans, hieß daher früher auch Wodens-, Woens- oder Wonestag.
Der Donnerstag ist der Tag des Gewittergottes Donar. Der Mittwoch Abend und der Donnerstag Morgen sollen die passendsten Zeiten zur Vertreibung der Würmer sein. In einem Diebssegen (Beschwörungsformel, die Diebe aufhalten, schädigen, aufspüren oder zur Rückgabe des Diebesguts zwingen sollen.) lese ich, daß er am Donnerstag Morgen vor Sonnenaufgang gesprochen werden müsse.
Der Freitag ist der Tag der Freya, der Göttin der Liebe. Er ist daher der beste Tag zur Feier der Hochzeit und Kindtaufe, die man andernfalls am Sonntag und Dienstag abhält. Am Freitag muß man die Nägel beschneiden. Er ist auch geeignet zur Ausübung der Sympathie. Bei den Friesen halten am Freitag die Hexen Umzug. Von diesem Tage heißt es auch: „Wer am Freitag lacht, muß am Sonntag weinen.“ Scherzhaft sagt man: „Et is Freedag vör den, de keen Släg krigt!“.
Der Sonnabend ist nicht der Abend vor dem Sonntag, sondern die Sonnenruhezeit. An jedem Sonnabend mit Ausnahme eines einzigen im Jahre (in der Karwoche) erwartet man Sonnenschein, wenn auch nur auf einen Augenblick. Wer seine Erbsen in der Erde mit leichter Mühe vor den Spaßen schützen will, dem wird geraten, sie am Sonnabend nach Sonnenuntergang zu legen.
„Dröge Dage“ nennt der abergläubige Landmann den Mittwoch, Freitag und Sonnabend. Was an diesen trockenen Tagen gesät und gepflanzt wird, gedeiht nicht.
Der Sonnabend Abend galt noch bei der vorigen Generation der Ruhe und Vorbereitung auf den Feiertag. Die Dreschdiele war zeitig geräumt, das Spinnrad stand im Winkel, und statt der Karten, mit denen sonst die Müßigen die Zeit vertrieben, wurde das Gesangbuch zur Hand genommen und einer las den um das Licht versammelten Hausgenossen das Evangelium vor.
Wer am Sonnabend Abend spinnt, sagt der alte Volksglaube, der findet nach dem Tode keine Ruhe in seinem Grabe und muß dann noch immer weiter spinnen.
Sage aus dem Sundewitt: “Zwei alte Frauen waren gute Freunde und die eifrigsten Spinnerinnen im Dorfe, so daß sogar am Sonnabend Abend ihre Räder nicht stille standen. Endlich starb die eine; aber am nächsten Sonnabend spät erschien sie der andern, die noch saß und eifrig spann, und zeigte ihr ihre glühende Hand, indem sie sprach: Sieh, was ich in der Hölle gewann, weil ich am Sonnabend Abend spann!“
Der Schinder von Dingwatt
Wie alt die Geschichte ist, kann ich nicht sagen. Großmutter hatte sie nicht erlebt,erzählte sie aber gerne, und wenn sie jest lebte, wäre sie etwa 140 Jahre alt. Die Geschichte muß also noch älter sein, lebt aber in Angeln noch im Munde des Volks. - Sie lautet etwa so:
Es war einmal ein Schinder zu Dingwatt („Racker“ sagten die Alten), der holte aus der Umgegend die gestorbenen Pferde, Kühe, Schafe, Hunde, Kazen und andere Tiere auf seiner Karre, zog ihnen daheim die Haut ab und verscharrte sie. Dafür bekam er einen geringen Lohn. So ein Geschäft war aber verachtet, und der Schinder galt wie alle seinesgleichen im Lande für unehrlich. Er durfte zu niemandem ins Haus kommen, und niemand kam zu ihm, denn wer mit ihm umging, wurde unrein und verachtet. Wer dem Meister „Kaltschlachter“ (so war sein amtlicher Titel) bei seiner Arbeit die geringste Handreichung tat, war unehrlich und mußte sein Lebenlang Schinder bleiben. Ja, wenn jemand gestohlen, geraubt oder ein anderes schweres Verbrechen begangen hatte und von der Obrigkeit verfolgt wurde, so hatte er sofort vor jeder weiteren Verfolgung Ruhe, wenn er nur einen Schinder erreichen und dessen Arbeit mit angreifen konnte; er war dann genug gestraft, denn er war aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen.
Einsam und still lebte nun so ein Verachteter dahin. Er besorgte sein Geschäft und mußte daneben dann und wann einmal dem Scharfrichter Hilfe leisten, wodurch er in den Augen seiner Mitmenschen noch tiefer sank. Die größte Not aber kam für ihn, wenn er oder ein Mitglied seiner Familie gestorben war, denn als dann konnte der Tote wohl einen Platz an der Kirchhofsmauer bekommen, aber jedermann scheute sich, ihn dorthin zu bringen.
Unser Schinder wohnte, wie gesagt, zu Dingwatt in einer kleinen Kate. Dingwatt aber liegt östlich von der alten Hardeskirche Strukdorf, in deren Nähe die Stätte des alten Dinggerichts gewesen. Es liegt an einem Bache, der hier die Landstraße nach Boel und Süderbrarup schneidet und ehedem durchwatet werden mußte. Jezt gehören die hier liegenden Stellen zum Kirchspiel Thumby, der Schinder aber soll sich zur Kirche nach Boel gehalten haben. Doch gleichviel, es war für ihn überall gleich.
Eines Tages stirbt ihm ein Kind, und für die Leiche wird ihm denn auch ein Grab neben dem Kirchhofe eingeräumt. Wie soll er aber die Leiche dahin schaffen? Auf seinem Schinderkarren kann er sein Kind doch nicht fahren, und niemand leiht ihm ein Fuhr- werk, niemand will sonst Hilfe leisten.
Was tut nun der gute Mann? Er bereitet seinem Kinde ein Grab im Garten und bestattet es hier selbst. Dann greift er zur Feder und schreibt mit schwerer Hand, aber getrostem Mute an seinen Landesherrn, den König. Er klagt sein Leid, betont, daß er mit seinem Amte einen notwendigen Posten in der Gesellschaft bekleide, sich und die Seinen damit eben so ehrlich durchgeschlagen habe, wie jeder andere Meister in seinem Geschäft, und dennoch für unehrlich gehalten werde. Er beschwert sich über seine Kirchspielsgenossen und bittet um Hilfe in seiner Not.
Die Antwort enthält den allerhöchsten Bescheid: „Dem Kinde des Schinders ist ein ehrliches Grab zu gewähren, die Kirchspielsleute der Nachbarschaft haben die nötige Handreichung zu tun zum Begräbnis, und der Schinder mit seiner Familie, wie auch die Schinder im Lande samt und sonders sind als ehrliche Leute auzusehen und zu behandeln. — Und das war der regelmäßige Schluß der Erzählung, so wurden die Schinder ehrlich.“
Die Sage setzt nun dieser Geschichte noch Folgendes hinzu:
So lange der Schinder unehrlich war, konnte man ihn wohl von der menschlichen Gesellschaft ausschließen, aber nicht aus der Kirche und von seinem Gott verdrängen. Er durfte aber auch hier nicht mit den ehrlichen Leuten aus und eingehen. Man baute daher an der Hinterseite der Kirche (dem Eingang gegenüber meistens an der Nordseite) eine eigene Thür, die zu einem abgeschlossenen, dichten Stuhlstande führte, von dem aus man wohl den Prediger hören und sehen, aber keinen Kirchenbesucher wahrnehmen konnte. Als nun der Schinder für ehrlich erklärt wurde, brach man in den Kirchen die Schinderstühle weg und mauerte die Tür dazu. Eine solche „Schinderthür“ kann man heutigen Tages noch an manchen Angler Kirchen sehen, und oftmals, wenn wir Knaben an dieser Thür vorübergingen, standen wir still und erzählten uns mit geheimem Grausen die Geschichte vom Schinder zu Dingwatt.
Sitten und Bräuche aus vergangenen Tagen
Hausgeräte, welche seit 50 Jahren ganz oder fast aus dem Gebrauche verschwunden sind. Die letzten 50 Jahre haben auf allen Gebieten. des Lebens mehr Veränderungen gebracht, als Jahrhunderte vorher. - Blicken wir beispielsweise nur einmal in das tägliche Leben besonders auf dem Lande -, so sind, entsprechend den veränderten Verhältnissen, eine ganze Zahl in unseren Kinderjahren noch unentbehrlicher Geräte so verschwunden und vergessen, daß unsere Kinder sie fast gar nicht mehr kennen. Wir könnten schon ein stattliches Museum solcher abgebrauchten, der Geschichte angehörenden Gegenstände ansammeln. Was mir so aus der Erinnerung einfällt, möchte ich hier kurz zusammenstellen, und was dabei etwa übersehen bleibt, mögen andere hinzufügen oder wenigstens hinzudenken.
Beginnen wir mit der Wohnstube. Da stand hinter dem Tische, unter der Fensterwand entlang, die niedrige, flache Grützbank, eine einfache Lade, in welcher Vorrat an Brot, Mehl, Grütze u. dgl. aufbewahrt wurde, und die zugleich als Sitz diente. Auf dem Tische stand in der Regel die große hölzerne Bierkanne, stets gefüllt für die „eigenen Leute“ wie für nachbarliche Gäste. Die Stühle hatten in der Regel einen hölzernen Sitz, manchmal auch einen solchen aus gekreuzten Lagen von Strohseilen, und waren bei festlichen Gelegenheiten auch wohl mit einem selbstgefertigten bunten Kissen belegt. Der Ofen war meistens ein sogenannter Beileger, d. h. ein viereckiger eiserner Kasten, auf hohem Fuße, und wurde von der Küche aus (vom Herde) besteckt und angezündet. Hier und da hatte er wohl einen Bratofen, war auch wohl an den beiden anderen Ecken mit einem Messingknopf geziert, und oben drauf stand auch mitunter eine blanke messingene „Stulpe,“ unter welcher Speisen warm gehalten, Äpfel gebraten wurden u. s. w. Die 4 Seitenwände waren in der Regel mit eingegossenen biblischen Bildern verziert. Da der Ofen hoch stand, die Diele meistens von Ziegelsteinen war, so brauchten alte Leute die „Fürkik,“ um die Füße zu wärmen. Die Beleuchtung wurde durch eine flache, oben offene Tranlampe beschafft, in welcher Binsenmark oder später ein dicker Baumwollenfaden den Docht bildete. Sie hing an einem an der Decke befestigten dreh- und verstellbaren gezahnten Gestänge, dessen Benennung mir entfallen ist. Hier und da, besonders bei festlichen Gelegenheiten, wurden selbst gegossene oder gezogene Talglichter gebrannt, bei denen die Lichtschere (Lichtputzschere/Dochtschere) unentbehrlich war. Um die letzten Stümpfe noch ausnuten zu können, wurde der „Provit“ gebraucht. - Die selbstgemachte Talgkerze (de „Praas“), sowie in feineren Häusern der Wachsstock (de, „Wastafel“) dienten zur augenblicklichen Beleuchtung beim Eintritt in die Küche oder einen andern dunklen Raum. An der Wand hing das „Resor“ (Tresor), dreieckig, mit einigen Regalen, auf welchen Tassen und anderes Kaffeegeschirr stand. Für die Beschäftigung der Frauen dienten: Das Webebrett (ein kleines viereckiges Gitter mit flachen, schmalen Stäben, die in der Mitte durchbohrt waren), um Bänder und Borten als Kleiderbesaß u. s. w. herzustellen, ferner eine Anzahl gedrechselter kurzer Stöcke mit rundem Kopfe, mittelst welcher Schnüre zum Besetzen der Kleider geflochten wurden, das waren die sog. „Slüngstöcke.“ - Das Spinnrad mit „Wock“ (Rocken) und „Heespreet“ (Heedespreite) war selbstverständlich in jedem Hause vorhanden mit dem Haspelholz und dazu gehörigem „Rasselpinn“ und „Winnpinn.“ Ebenso unentbehrlich waren die „Wollkratzen“ und die „Flachshechel.“ Beim Stricken diente, zur Schonung der Kleider, der „Strichpinn,“ in dessen kleiner Höhlung die Stricknadel festgestellt wurde. Beim Nähen wurde neben dem Preßeisen der „Gnigelsteen“ (ein halbkugeliger Glasfluß) zum Glätten der Nähte u. s. w. gebraucht, auch beim Stopfen der Strümpfe als Unterlage in den Strumpf geschoben.
In der Küche fand sich überall die Kohlbütte mit dem an langem Stiele befestigten s-förmigen Kohlstößer, um Grünkohl damit fein zu stoßen, auch wohl Kartoffeln oder Rüben fürs Vieh zu zerkleinern. (Jetzt ersetzt durch „Wrickmesser“ und „Hackmaschine.“) Der alte Besemer, eine gedrechselte Holzstange mit schwerem Kolben und verschiebbarem Griff, war das übliche Gewicht. Die runde Pfeffermühle (Pepermöhl) ersetzte den jüngeren Mörser, und die kleine Senfmühle (Sempquern) diente zur Bereitung des Senfes (Musterd). Hier fand sich auch die Lichtform zur Herstellung der nötigen Talglichte. Wenn das allabendlich auf dem Herde unter der Asche „gerakte“ Feuer ausgegangen war, wurde mit Stahl, Stein und Schwamm (früher Zunder „Tünderkruk“) dem Mangel mühsam abgeholfen, oder man holte im Kik (Feuerträger) - im Notfall in einem Holzschuh - Feuer beim Nachbarn. Kaffeebrenner und Kaffeemühle konnten nicht entbehrt werden, kommen jetzt auch wohl bald außer Gebrauch.
Im Backhause stand neben dem großen Backtroge fast überall die Handmühle (der „Quern“) zum mühsamen Schälen des Buchweizens, um Grütze zu gewinnen, wie auch zum Quetschen von Malz. Hier hatten meistens auch die Biertonne und der Braukessel (Bulketel) ihren Platz, und hier wurde häufig das Bier bereitet. Daneben lag denn auch der „Geßkranz,“ um den sich beim Brauen die Hefe ansetzte.
In der Scheune standen noch die alten täglichen Wagen, deren Räder statt durch eine Schraube durch eine angesteckte eiserne Lünse gegen Ablaufen von der Achse gesichert waren. Hier oder auf dem Boden oder in einer Rumpelkammer fanden sich sich noch die Flachsbreche (de „Brak“), der Schwingstock (das Swingholt) und das Schwingblatt, wohl fast alle durch Brech- und Schwingmaschinen verdrängt, und damit haben denn auch die frohen Zusammenkünfte der Frauen und Mädchen zum gemeinschaftlichen Schwingen des Flachses wohl schon lange ihr Ende gefunden.












